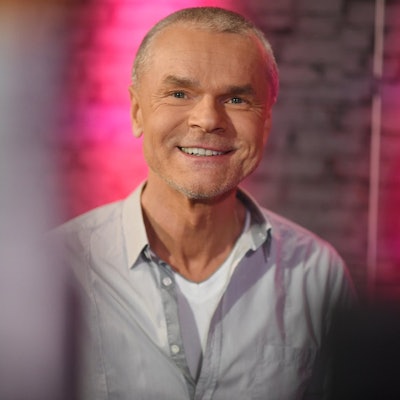Foto-Ausstellung von Boris BeckerDas Schweigen über das Grauen

Ein Bunker in der Hamburger Löwenstraße.
Copyright: Becker
- Der Fotograf Boris Becker zeigt im Kölner Mediapark eine ganz besondere Ausstellung.
- 190 Hochbunker hat er im Wandel der Zeit fotografiert und ihre Entwicklung zusammengestellt.
- Dabei setzt er auf drei Ebenen, die alle eine ganz eigene Geschichte erzählen.
Köln – Sie verschweigen das Grauen. Jene knapp 190 Hochbunker, die Boris Becker nun in der Photographischen Sammlung der SK-Stiftung Kultur zeigt, erzählen nichts von Bombenvolltreffern, Panik oder Selbstmorden im Inneren. Sie sind steinerne Überlebende, die der Kölner Fotograf von 1984 bis 1990 in 45 westdeutschen Städten aufspürte.
Rund 160 Originalabzüge der meist schwarz-weißen Großformatkamera-Aufnahmen hat der Künstler als „freundliche Dauerleihgabe“ der Photographischen Sammlung anvertraut, wie Leiterin Gabriele Conrath-Scholl sagt. Belegt wird in Vitrinen auch die Recherche in vordigitaler Zeit: Da sieht man neben Auskunftsersuchen an Städte und Behörden die mit Kreuzchen gepickten Falk-Stadtpläne – Beckers Reiseführer.
Überrascht von opulenten Werken
Dass seine erste Bildserie so opulent werden würde, ahnte er anfangs nicht. „Das hat sich während der Arbeit immer mehr aufgeschichtet.“ Wobei die Fotografie hier an ihre Grenzen stößt. Denn die Hochbunker sind Camouflage-Künstler, die ihre Funktion damals sowohl vor dem Feind wie vor der sonst verstörten Bevölkerung verbargen. Deshalb hinkt der Vergleich mit den Förderturm- oder Hochöfenserien von Beckers Düsseldorfer Akademielehrern Bernd und Hilla Becher.
„Ist das überhaupt ein Bunker?“ fragte sich der 1961 geborene Lichtbildner etwa angesichts eines täuschend echten Bauernhauses in Mönchengladbach. In Norddeutschland goss man die Schutzbauten gern in Turmform, in München ähneln sie barocken Kleinkirchen, und sogar das bei den Nazis gewiss nicht beliebte Bauhaus stand in der Leverkusener Karlstraße einem Hochbunker Modell.
Serie auf drei Zeitebenen
Die Serie funktioniert heute auf drei Zeitebenen: Einerseits zielt sie ins Jahr 1940, als das Sofortprogramm zum Schutz der Zivilbevölkerung begann und Bunker etwa an die Stelle zerstörter Synagogen traten und von KZ-Häftlingen oder Zwangsarbeitern errichtet wurden. Dann natürlich in die 80er Jahre, die nun auch mit Aufnahmen präsent sind, die der Fotograf anfangs verschmäht hatte. Sie zeigen das Umfeld der Bunker, und da lassen Autos, Werbung und Parolen („Nie mehr! Stoppt Strauß!“) den rebellischen Zeitgeist wieder erwachen.
Dritte Ebene: Da das damals schon Historische nun auch wieder rund 30 Jahre zurückliegt, sprengt der Künstler spätere Großformate von „Architekturen und Artefakten“ in die höchst intelligent gehängte Schau. Den zerschlitzten Fassaden der von den Alliierten „entfestigten“ Bunker steht aus Beckers „Fakes“-Serie der zerstörte Halbedelstein gegenüber, der als Kokainversteck diente.
Mit den Bunkern begann also seine Faszination für jene Dinge, die nicht sind, was sie zu sein vorgeben. Oder in denen sich gegensätzliche Welten so stoßen wie am Hamburger Johannisbollwerk: Neben dem notdürftig weggekratzten Hakenkreuz hängt das Schild eines portugiesischen Restaurants.
Das könnte Sie auch interessieren:
Hochbunker waren nach 1945 zuerst Notunterkünfte, später mit hineingestemmten Fenstern aparte Wohnhäuser und Künstlerdomizile. Rund 20 farbige Bilder zeigen die zweite Camouflage-Welle, in der manche Bunker in Pastell- oder Popfarben bemalt wurden. Etwa in der Kölner Helenenwallstraße oder Berliner Straße. Der Fotograf schmunzelt über diese aufgeschminkten Kirchenfenster, die man normalen Bauten erspart.
Mit ihren knapp 200 Fotografien und vielen Dokumenten ist dies eine sozial- wie kulturhistorisch faszinierende Schau. Sie birgt Hunderte von Geschichten und verlängert die ästhetischen Leitlinien des Lichtbildners bis in die Gegenwart.Ins Innere der Betonklötze blickte Boris Becker nicht. Aber das besorgt im üppigen Buch (siehe Info) der mit ihm befreundete Autor Marcel Beyer. Er halluziniert in einem Langgedicht „Die Bunkerkönigin“ herbei, „ein ungewaschenes Trümmerkind, das halb im Schlaf Rost vom Moniereisen leckt“.