Ute Meiers verglich die Bezahlkarte für Geflüchtete mit dem Judenstern und erntete deshalb viel Kritik. Zu Unrecht, meint Dr. Mark Frenkel.
„Judenstern-Vergleich“Jüdische Gemeinde Köln stellt sich hinter Wesselinger SPD-Politikerin Meiers
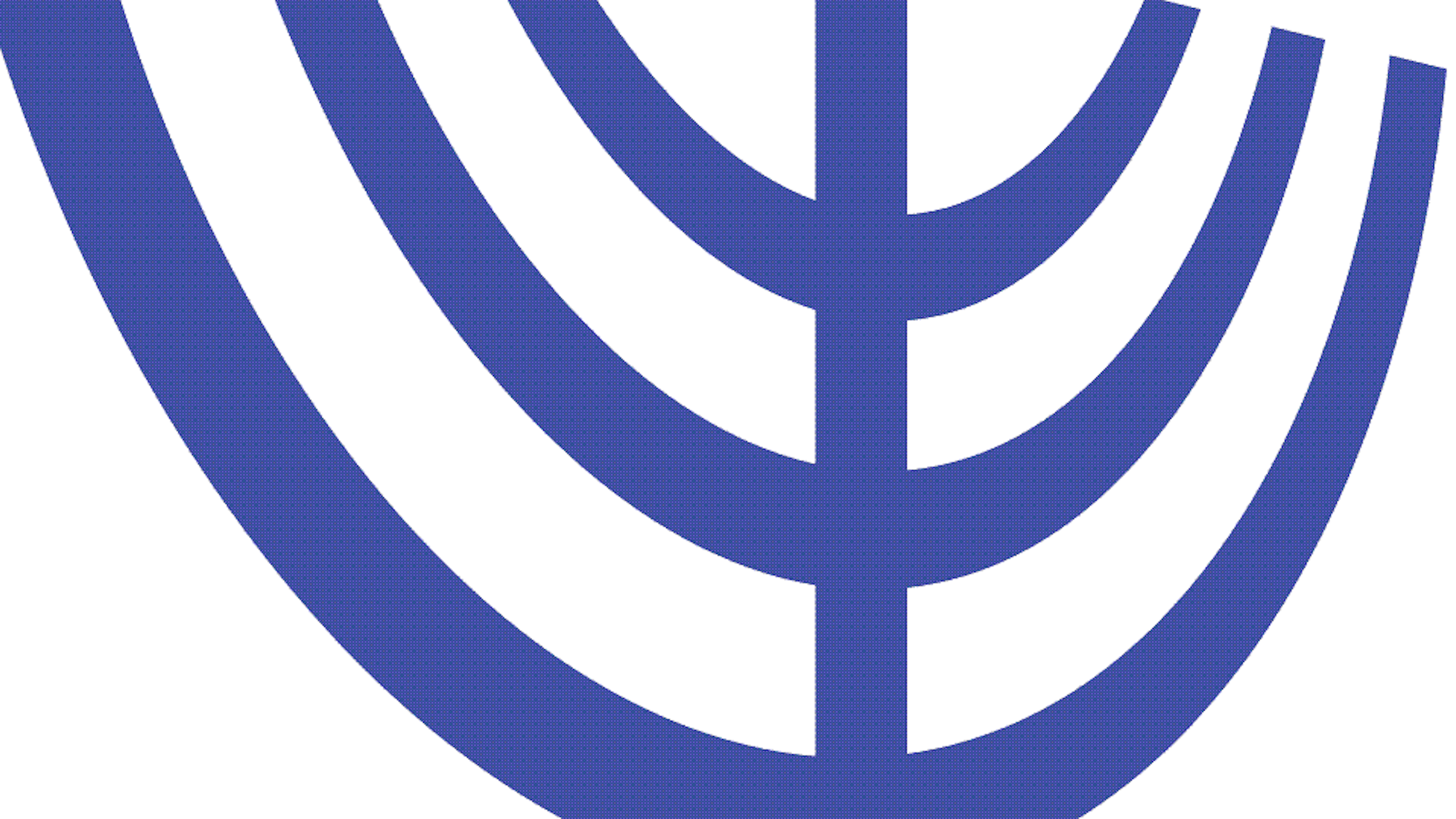
Das ist das Logo der Jüdischen Gemeinde in Köln. Gemäß ihrer Richtlinien veröffentlicht sie keine Fotos ihrer Vertreter.
Copyright: Jüdische Gemeinde Köln
Eine Äußerung der SPD-Politikerin Ute Meiers hatte in Wesseling einen handfesten Skandal ausgelöst. Sie hatte Ende April die Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete mit einem „digitalen gelben Stern“ verglichen. Den mussten Juden im Deutschen Reich seit 1941 als Folge der Rassengesetze tragen.
Die Sozialdemokratin hatte sich später entschuldigt und auf internen und externen Druck den Vorsitz im Ausschuss Sport, Freizeit, Kultur und Städtepartnerschaften niedergelegt. Die Wesselinger SPD hat ein Parteiordnungsverfahren gegen Meiers eingeleitet. Sie wirft ihr Geschichtsvergessenheit und Verharmlosung der NS-Verbrechen, insbesondere an den Juden, vor.
Interview mit Vorstand der Jüdischen Gemeinde Köln
CDU und Grüne hatten zudem zunächst beantragt, ihr den Ehrenring ihrer Heimatstadt abzuerkennen, den Antrag dann aber zurückgezogen.
Jörn Tüffers sprach mit Dr. Mark Frenkel vom Vorstand der Jüdischen Gemeinde Köln über den „Judenstern-Vergleich“ und über politische Konsequenzen.
Wie bewerten Sie den Vergleich, den Frau Meiers gewählt hat?
Wir haben kein Problem damit, wenn historische Parallelen zur Diskriminierung von Jüdinnen und Juden im nationalsozialistischen Deutschland gezogen werden, um staatliche Diskriminierung gegenüber bestimmten Gruppen in der Gegenwart aufzuzeigen. Im Gegenteil: Aus unserer Sicht erinnert jede solche Analogie an die Schrecken der Shoah und trägt dazu bei, ähnliche Verbrechen in der Zukunft zu verhindern.
Sehen Sie Parallelen zwischen einer Bezahlkarte für Geflüchtete und dem gelben Davidstern?
Natürlich kann jede Form der erzwungenen Kennzeichnung zur Unterscheidung von Menschen Assoziationen mit dem „Judenstern“ hervorrufen. Dabei ist es jedoch wichtig, erstens klar zwischen dem „Judenstern“ und dem Davidstern zu unterscheiden und zweitens zu bedenken, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland bis heute durch die Angabe ihrer Religionszugehörigkeit auf der Lohnsteuerkarte gekennzeichnet werden.
Man kann sagen, dass der deutsche Staat Jüdinnen und Juden auch heute noch gegen ihren Willen kennzeichnet
Wo macht sich das bemerkbar?
Bei einer Bewerbung, der Eröffnung eines Bankkontos oder der Anmietung einer Wohnung ist für den Gegenüber somit sofort erkennbar, dass es sich um eine jüdische Person handelt. Da diese Kennzeichnung nur durch den Austritt aus der Religionsgemeinschaft entfernt werden kann, kann man sagen, dass der deutsche Staat Jüdinnen und Juden auch heute noch gegen ihren Willen kennzeichnet. Ein solches Vorgehen existiert in keinem anderen Land der Welt.
Äußerungen der SPD-Politikerin nicht als antisemitisch bewertet
Wie bewerten Sie die Äußerungen und Erklärungen der SPD-Politikerin zu ihrem Vergleich?
Wir betreiben keine Politik und konzentrieren uns ausschließlich auf eindeutig antisemitische Äußerungen. Die genannten Aussagen von Frau Meiers betrachten wir nicht als antisemitisch. Wir sind der Ansicht, dass der Begriff „Antisemitismus“ von ihren politischen Gegnern für eigene Zwecke instrumentalisiert wird – und damit die wichtige Arbeit gegen echten Antisemitismus in Deutschland entwertet.

Ute Meiers steht in weiten Teilen der Wesselinger Politik in der Kritik.
Copyright: Ute Meiers
Halten Sie ihren Rückzug vom Vorsitz des Kulturausschusses für ausreichend – oder aber müssten andere politische Konsequenzen gezogen werden ?
Wir lehnen in diesem Fall jegliche politischen Konsequenzen ab und betrachten den Rückzug vom Vorsitz des Kulturausschusses als eine erzwungene Reaktion von Frau Meiers – als anständiger Mensch – auf eine Welle unbegründeter Kritik.
Ist die Äußerung ein Ausrutscher oder aber Alltag im Jahre 2025 in unserem Land?
Wir sind der Meinung, dass vor jeder Kritik an einer Person wegen Antisemitismus zunächst an die Definition von Antisemitismus erinnert werden sollte. Auf diese Weise lassen sich viele Konflikte auf friedlichem Wege von selbst klären.
Welche Gefahren sehen Sie in solchen Vergleichen?
Die zwangsweise Kennzeichnung von Menschen zur Unterscheidung führt immer zu gesellschaftlichen Spannungen. Wenn das Beispiel der Schoah den Menschen hilft, eine Lehre aus der Geschichte zu ziehen, wäre das bereits ein großer Fortschritt – doch leider werden die Lektionen der Geschichte nur allzu schnell vergessen.
Was muss Gesellschaft tun, damit dieser schleichende Antisemitismus sich nicht ausbreitet?
Man sollte den Film „Das Experiment“ öfter im Fernsehen zeigen, damit allen die Banalität des Bösen bewusst wird.
Das Experiment ist ein deutscher Psychothriller von Oliver Hirschbiegel aus dem Jahr 2001, der auf dem Roman „Das Experiment Black Box“ von Mario Giordano basiert. Die Handlung lehnt sich an das Stanford-Prison-Experiment von 1971 an. Amerikanische Psychologen, unter anderem Philip Zimbardo, installierten ein Gefängnis, um eine Feldstudie zum menschlichen Gewaltverhalten durchzuführen. Die Hypothese war, dass Gewalt und Boshaftigkeit keinen inneren Beweggründen folgten, sondern durch äußere Einflüsse – wie zum Beispiel selbst erlebte Gewalt – hervorgebracht werden.
Via Zeitungsannonce in Palo Alto wurden die Teilnehmer für dieses Experiment gesucht, die pro Tag 15 Dollar erhielten. Damals war es üblich, dass Gefangene in den USA ihre Kleidung abgaben, entlaust wurden und eine Häftlingsnummer zugeteilt bekamen. Die Wärter sollten für Ordnung sorgen. (jtü)
