Rechte und PflichtenDiese Urteile sollten Ebay-Nutzer kennen
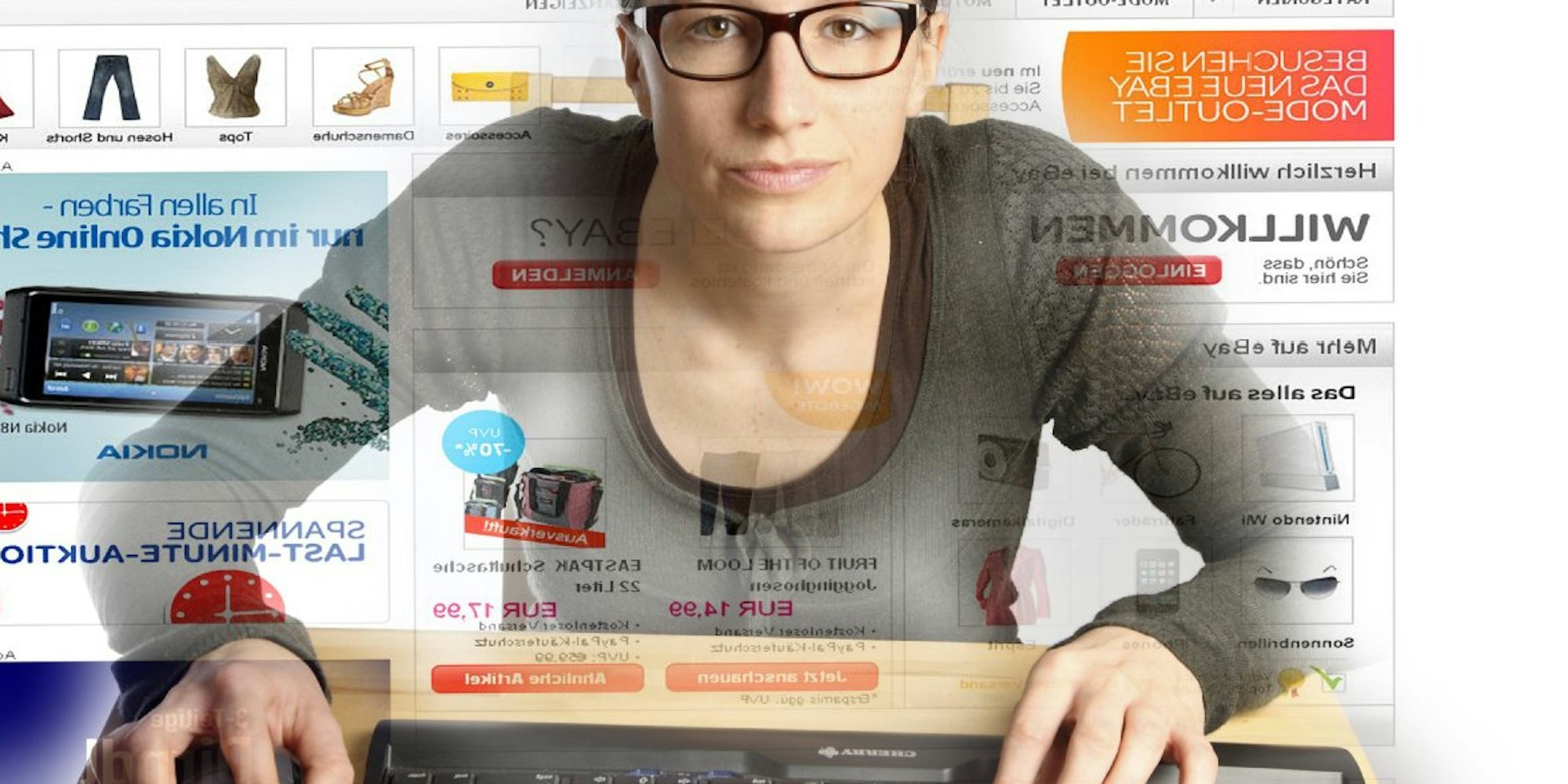
Viele Internetnutzer handeln über Ebay, sie kaufen dort nicht nur Artikel, sondern verkaufen beispielsweise nicht mehr benötigte Gegenstände über die Online-Plattform. Ihre Rechten und Pflichten sollten beide Seiten kennen.
Copyright: imago stock&people Lizenz
Dieser Klick bei einer Ebay-Auktion hat sich für den Bieter gelohnt: Nicht nur, dass der Käufer in der Online-Versteigerung einen gebrauchten VW Passat für einen Euro ergattert hatte. Jetzt erhält er sogar noch Schadenersatz dafür, weil der Anbieter ihm den Wagen vorenthalten hat.
So hat es der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch (12.11.2014) entschieden. Die Richter wiesen die Revision eines Verkäufers aus Thüringen ab, der die Online-Versteigerung seines alten VW Passat überraschend und letztendlich unwirksam abgebrochen hatte. Das Urteil wird die berüchtigten sogenannten „Abbruchjäger“ freuen, die genau auf solche Fälle aus sind. Und es ist zugleich eine Warnung an all diejenigen, die im Internet ihre gebrauchten Gegenstände versteigern wollen und das mit einer gewissen Leichtfertigkeit angehen.
Aber es gibt noch mehr Ebay-Urteile, die Bieter und Anbieter kennen sollten. Wir haben hier einige wichtige für Sie gesammelt.
Die Ware muss halten, was das Angebot verspricht
Wer auf der Auktionsplattform etwas verspricht, muss es auch einhalten - wenn nicht, kann es teuer werden. Mit dem häufig verwendeten Zusatz „keine Gewährleistung“ versuchen viele private Verkäufer auf Ebay, sich vor der Haftungsfalle zu schützen. Sätze wie „Verkauf von privat an privat unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung“ finden sich häufig in Ebay-Auktionen der Privatanbieter. Doch hat der Bundesgerichtshof (BGH) 2013 klargestellt, dass dies nicht so einfach geht.
Auch ein privater Anbieter muss dafür haften, dass die von ihm verkaufte Ware hält, was er in seiner Angebotsbeschreibung verspricht (Az.: VIII ZR 96/12). Verkäufer müssen also über die von ihnen angebotenen Waren wahre und vollständige Angaben machen. Sind die Angaben falsch, ist ein in der Beschreibung formulierter Ausschluss der Gewährleistung unwirksam. Auch der erklärte Ausschluss jeglicher Gewährleistung entbindet laut BGH-Urteil private Verkäufer nicht von der Haftung, wenn sie eine Eigenschaft in der Beschreibung zugesichert haben.
Vorsicht bei fremden Fotos im Angebot!
Teuer für Anbieter kann es werden, wenn sie fremde Bilder kopieren und ins eigene Angebot einfügen Diese Erfahrung musste der Verkäufer eines Navigationsgeräts machen. Der Mann hatte das Navi als privater Verkäufer für 72 Euro angeboten. Doch das Foto, das er in der Auktion verwendete, hatte er zuvor im Netz gefunden und kopiert. Dabei handelte es sich um ein professionelles Produktfoto. Der Fotograf ließ den Mann durch seinen Anwalt abmahnen, jedoch ohne Erfolg. Daraufhin klagte der Fotograf auf Unterlassung und verlangte Schadensersatz.
Das Brandenburgische Oberlandesgericht verurteilte den Verkäufer 2009 zur Zahlung von 40 Euro Schadensersatz und 100 Euro Abmahnkosten - weniger, als der Fotograf gefordert hatte. Die Begründung: Der Kläger könne vom Beklagten lediglich 40 Euro Lizenzgebühren verlangen, weil das Foto nur wenige Tage im Internet verwendet worden sei. Da der Anbieter erstmals das Urheberrecht verletzt, das Foto lediglich für einen Privatverkauf verwendet habe und daher die Rechtsverletzung des Fotografen nicht erheblich gewesen sei, hielten sich die Abmahnkosten in Grenzen. (Az.: 6 U 58/08)
Widerrufsrecht darf nicht versteckt werden
Beim Kauf eines Artikels im Internet haben Verbraucher ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Sie können also von dem Kauf innerhalb von 14 Tagen zurücktreten. Auf ihr gesetzliches Widerrufsrecht müssen Kunden von gewerblichen Verkäufern jedoch klar und verständlich hingewiesen werden. Das hat das Oberlandesgericht Hamm 2005 in einem Berufungsverfahren bestätigt.
Ein Verkäufer handelte bei Ebay mit Computerzubehör. Im Angebot wurde der Artikel beschrieben und es gab einige Angaben zur Kauf-Abwicklung. Die Belehrung über das gesetzliche Widerrufsrecht war jedoch nicht innerhalb des Angebots, sondern nur unter der Rubrik „Angaben des Verkäufers“ zu finden. Laut Urteil des Oberlandesgerichts ist das nicht rechtmäßig: Eine Widerrufsbelehrung sei nicht verkäuferbezogen, sondern kaufbezogen. Deshalb vermute der Käufer eine Belehrung über das Widerrufsrecht nicht unter der Rubrik „Angaben zum Verkäufer“ und stoße hier nur zufällig darauf. (Az.: 4U2/05)
Bei Bewertungen Händler und Ware trennen
Die Verkäuferbewertung ist nicht zur Rezension bestellter Produkte gedacht. „Der Händler ist schließlich nicht dafür verantwortlich, wenn einem das Produkt nicht gefällt“, erklärt Thomas Lapp von der Arbeitsgemeinschaft IT-Recht im Deutschen Anwaltverein. Ist die Ware mangelhaft, wendet sich der Käufer am besten zuerst an den Händler. „Erst, wenn der sich dann nicht darum kümmert, ist eine negative Bewertung des Händlers gerechtfertigt“, sagt Lapp. Dieser sollte aber die Möglichkeit haben, zu reagieren und das Produkt gegebenenfalls umzutauschen oder das Geld zurückzuzahlen.
Die Verkäufer könnten sich von der schlechten Bewertung persönlich angegriffen fühlen und rechtliche Schritte gegen den Verfasser der Bewertung einleiten. 2014 entschied das Oberlandesgericht München, dass ein Käufer seine schlechte Bewertung eines Händlers beim Internet-Auktionshaus Ebay löschen muss. Der Käufer von Bootszubehör hatte sich in seiner Rezension über Produktmängel beschwert (Az.: 18 U 1022/14). Ein wahrer Ebay-Bewertungskommentar muss aber nicht gelöscht werden (Az.: 28 S 4/09).
Gefälschte Rezensionen entstehen entweder von bezahlten Schreibern oder sogar vollautomatisch am Computer. „Es gibt Bewertungen, die häufig wortgleich oder wortähnlich sind“, sagt Online-Marketing-Experte Christian Bachem. „Das deutet darauf hin, dass sie von einer Maschine stammen, oder von einem Menschen, der dafür bezahlt wird, in möglichst wenig Zeit möglichst viele Bewertungen zu schreiben.“
Nur positive Bewertungen hat kaum ein Händler. Kunden sind in der Regel motivierter, eine Bewertung abzugeben, wenn etwas schlecht gelaufen ist und wollen dann ihrem Ärger Luft machen. „Wenn man erkennt, da ist ein Händler, der hat viele Bewertungen und die sind ausnahmslos positiv, dann ist das verdächtig“, sagt Bachem.
Händler, die gute Bewertungen kaufen, können meist nicht alle Kanäle abdecken. Deshalb sollten Käufer immer mehrere Bewertungsplattformen prüfen, vor allem wenn es um viel Geld geht: „Bei einer kritischen Kaufentscheidung, sollte man immer mehrere Portale nutzen“, rät Bachem. „Wird ein Händler überall ähnlich bewertet? Gibt es Ausreißer?“
Worauf unter anderem private Verkäufer achten müssen, lesen Sie auf der nächsten Seite.
Gewerblich? Privat? Angebotsmenge entscheidet
Wann ein Verkäufer als gewerblicher Verkäufer einzustufen ist, ist nicht immer eindeutig. Das Oberlandesgericht Hamm urteilte in einem Fall, in dem ein Wettbewerber einen Anbieter, der sich als privater Verkäufer bezeichnete, verklagte. Der Kläger verkaufte Schallplatten und war als gewerblicher Verkäufer eingetragen. Der Beklagte tat dasselbe, hatte sich jedoch als privater Verkäufer einstufen lassen. In einem Zeitraum von sechs Wochen bot er 500 Artikel zum Verkauf an. Ein Viertel der Schallplattenmenge verkaufte er schließlich.
Obwohl er lediglich ein Viertel der Ware verkauft habe, sei er als Unternehmen einzustufen, urteilte das Gericht. Denn er habe innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums über 500 Artikel angeboten. Es handele sich dabei nicht mehr um das gelegentliche Anbieten eines privaten Verkäufers. Der Beklagte habe als Unternehmen, nicht als privater Verkäufer und deshalb in der Folge wettbewerbswidrig gehandelt. (Az.: I-4 U 204/10)
Achtung! Manchmal wird Umsatzsteuer fällig
Wer regelmäßig in Internet in größerem Umfang Gegenstände verkauft, muss dafür möglicherweise auch Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) ans Finanzamt zahlen. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass beim Verkauf einer Vielzahl von Waren über Jahre hinweg eine „nachhaltige, unternehmerische und damit umsatzsteuerpflichtige Tätigkeit“ vorliegen kann. Bei dem Prozess ging es um ein Ehepaar, das über Ebay Modelleisenbahnen, Puppen, Porzellan, Briefmarken oder auch Software verkaufte (Az.: V R 2/11).
Das Paar gab bei Ebay an, es handle sich um Privatverkäufe. Es meldete die Geschäfte nicht beim Finanzamt, Steuerfahnder wurden aber darauf aufmerksam. Daraufhin forderte der Fiskus rund 11.500 Euro Umsatzsteuer für die Jahre 2003 bis 2005. In dieser Zeit hatte das Paar bei 841 Verkäufen etwa 83.500 Euro erzielt. Die Verkäufer argumentierten, dass es nur um die Auflösung ihrer Sammlungen und somit um ihr Privatvermögen gegangen sei. Der BFH urteilte, dass es nicht darauf ankomme, ob die Eheleute schon beim Kauf der Sammlergegenstände an den Wiederverkauf gedacht haben oder nicht. Wesentlich sei auch, dass die Ebay-Verkäufer wie ein Händler „aktive Schritte zum Vertrieb der Gegenstände“ unternommen hätten.
Macht ein Verkäufer irrtümlich falsche Angaben bei der Produktbeschreibung, hat er das Recht, die Auktion vorzeitig zu beenden. Das ist etwa der Fall, wenn falsche Funktionen angegeben sind. Auch bei einer irrtümlich falschen Angabe des Start- oder Mindestpreises darf die Auktion beendet werden. Allerdings nur, wenn sich die Fehler nicht durch Ergänzungen der Artikelbeschreibung ausräumen lassen.
Ist es dem Verkäufer unmöglich, das beschriebene Objekt zu verkaufen, kann die Auktion auch beendet werden. Das ist beispielsweise der Fall, wenn der Artikel unverschuldet beschädigt oder zerstört wurde. Auch im Falle eines Diebstahls oder falls sich herausstellt, dass der Verkauf gegen geltendes Recht verstoßen würde, darf der Verkäufer einen Rückzieher machen.
Die Auktion zu beenden, weil man den Artikel anderweitig verkaufen oder weitergeben möchte, gestatten die Ebay-Regeln nicht. Auch wenn man sich zwischenzeitlich entschließt, doch nicht zu verkaufen, ist ein vorzeitiges Ende einer Ebay-Auktion nicht erlaubt. Außerdem dürfen Anbieter auf Online-Marktplätzen den Verkauf nicht einfach mit einem Verweis auf Phishing rückgängig machen, wenn sie die Hacker-Attacke nicht beweisen können (Az.: 21 O 135/13).
Haftet die Post für das verlorene Päckchen?
Haftet die Post nur, wenn ein Päckchen per Einschreiben, Einschreiben Einwurf, Eigenhändig, per Rückschein oder Nachnahme versandt wurde? Mitte Juni 2012 versandte eine Münchnerin ein Paar Golfschuhe, die sie über Ebay für 41,56 Euro verkauft hatte, per Post an den Käufer. Die Golfschuhe kamen allerdings nicht beim Empfänger an, auch ein Nachforschungsauftrag blieb erfolglos. Die Verkäuferin zahlte daher den Kaufpreis zurück und verlangte den Betrag als Schadenersatz von der Post zurück.
Die Post aber berief sich auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), auf die in der Filiale in einem Aushang deutlich hingewiesen worden sei und die auch einsehbar seien, und verweigerte die Zahlung. Sie sei nicht auf die AGB hingewiesen worden, entgegnete die Frau. Das Amtsgericht München gab ihr Recht. Die AGB seien nicht wirksam in das Vertragsverhältnis einbezogen worden. Der Aushang über Produkte und Preise in der Filiale mit dem Vermerk „Näheres regeln unsere AGB sowie eine Übersicht, die Sie in den Postfilialen einsehen können“ genüge dafür nicht. Dies sei überraschend und nicht wirksam, selbst wenn die Geschäftsbedingungen in der Filiale einsehbar gewesen wären.
Gibt es ein Recht auf „Originalware“?
Ebay verbietet Verkäufe von Plagiaten ausdrücklich. Wer bei dem Auktionshaus hochwertige Gegenstände verkauft, sollte sich vor dem Einstellen genau versichern, dass es sich nicht um ein Plagiat handelt. Nicht nur wegen des Ebay-Verbots: Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs von 2012 können dem Verkäufer auch hohe Schadensersatzforderungen drohen (Az.: VIII ZR 244/10). Ein niedriger Startpreis bei einer Auktion ist demnach kein Anzeichen dafür, dass es sich um ein gefälschtes Produkt handelt.
Im Streitfall ging es um ein angebliches Luxus-Handy, bestückt mit Gold und Diamanten, im Wert von 24.000 Euro. Der Käufer hatte von Ebay Schadenersatz verlangt, weil sich das Handy als Plagiat erwies. Er klagte gegen die Anbieterin, die das Mobiltelefon „Vertu Weiss Gold“ per Foto zum Verkauf anbot - und zwar ohne Mindestpreis und zum Startpreis von einem Euro, Zustand „gebraucht“. Die Anbieterin hatte sich „an alle Liebhaber von Vertu“ gewandt, einem Hersteller von Luxus-Handys. Der Kläger gab ein Maximalgebot von 1.999 Euro ab und bekam für 782 Euro den Zuschlag. (gs, mit Material von dpa)
