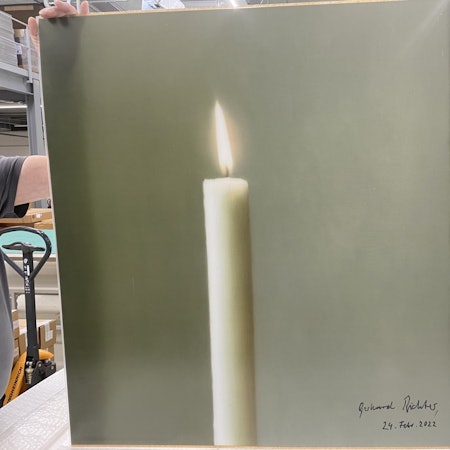Mord an New Yorks WohltäterRoman „Der große Fehler“ würdigt Andrew Haswell Green

Die Brooklyn Bridge und die Manhattan Bridge verbinden die beiden Stadtteile New Yorks.
Copyright: picture alliance / dpa
„Halte die Axt wie in Mann“, herrscht ihn sein Vater an, doch Andrew Haswell Green wird beim Holzhacken lange eher mädchenhaft wirken. Ohnehin hat der Bauernsohn aus Worcester/Massachusetts vor, ein eleganter Gentleman zu werden. Als er am 13. November 1903 mit 83 Jahren auf offener Straße vom Schwarzen Cornelius Williams erschossen wird, hat er dies fürwahr geschafft: Sein Name steht für die Gründung des Central Parks, der New York Public Library, des Metropolitan Museum of Art und für die Vereinigung von Manhattan und Brooklyn.
Autor flaniert durch ein langes formatsprengendes Leben
Wie aus einem Kramladenverkäufer der „Vater von Greater New York“ wird, erzählt der Engländer(!) Jonathan Lee in seinem fesselnden Buch „Der große Fehler“. Ein faktengestützter Historienroman, gewiss, doch keiner, der sich an der Zeittafel brav von unten nach oben hangelt.Vielmehr flaniert der Autor unberechenbar durch die Phasen eines langen, formatsprengenden Lebens, wobei er gleich mit dessen gewaltsamem Ende beginnt.
Der Mord am Wohltäter macht Schlagzeilen, sogar der US-Präsident dringt auf rasche Aufklärung, die Inspektor McClusky freilich nicht in den Schoß fällt. Williams gibt an, sein Motiv hänge mit der farbigen Prostituierten Bessie Davis zusammen. Doch was hat der stets diskrete Mr. Green mit ihr zu tun, der bis zuletzt die elterliche Mahnung beherzigt: „Zurückhaltung. Das ist der Schlüssel zu einem ehrbaren Leben, Andrew.“
Drama einer ungelebten Männerliebe
Der Sohn hält sich zurück, immer. Als er mit 15 beim Ringkampf mit seinem Freund Sam Allen etwas Unerhörtes spürt – „Abscheu oder Verlangen“ –, als er später immer mal wieder ähnliche Episoden erlebt. Ja, selbst als er in dem Anwalt und politischen Strippenzieher Samuel J. Tilden viel mehr als einen Freund und Mentor findet.
Dieses Drama einer ungelebten Männerliebe mag der heimliche Glutkern des Romans sein, der jedoch ebenso brillant etliche andere Welten erschließt. Da ist Andrews entscheidendes Umbruchjahr in Trinidad, wo er auf einer Zuckerrohrfarm den Rassismus der weißen Betreiber hassen und die eigene Tatkraft lieben lernt. Oder sein Hunger nach Bildung, der anfangs nur in Privatbibliotheken gestillt werden kann.
Wer ist der Autor?
Jonathan Lee (Foto), 1981 im englischen Surrey geboren, arbeitete zuvor in einer Anwaltskanzlei in London und Tokio. Inzwischen lebt er in New York, ist Angestellter eines Verlags und schreibt neben Romanen auch Drehbücher. Das Denkmal im Central Park brachte ihn auf die Idee zu diesem Buch, für das Andrew Greens unveröffentlichte Tagebücher und Briefe in der Historical Society Library die wichtigsten Quellen waren. (Wi.)
Buchstäblich überwältigend glückt das Porträt von New York zwischen stinkendem Urschlamm und sich langsam daraus erhebender Metropole, der Rückblick in eine Zeit, da der Broadway Boulevard der Ladies wie der Ratten ist.
Roman erzählt gleich zwei Geschichten
Plastisch ausgepinselte Milieus und fein schraffierte Psychogramme lassen dieses Buch funkeln. Letztlich erzählt Lee zwei Aufsteigergeschichten: die von Green, der Jura studiert, Partner in Tildens Kanzlei wird und bald als der Mann gilt, „der Dinge zu Ende bringt“. Selbst so schwierige wie den Central Park, der den Raffzähnen der Stadt als pure Platz- und Geldverschwendung verhasst ist.
Das könnte Sie auch interessieren:
Und dann die fast ebenso sagenhafte Karriere von Bessie Davis, der eigentlich chancenlosen Schwarzen, die als Lieblingshure der urbanen Elite und als Bordell-Unternehmerin zu fantastischem Reichtum gelangt.Natürlich wird schließlich auch das Rätsel des Mordes gelöst und die eher bescheidene posthume Würdigung des Opfers erwähnt: eine Steinbank im Central Park, deren Inschrift meist von Taubendreck bedeckt ist. Aber Andrew Haswell Green hat ja immer gewusst, „dass all seine öffentliche Arbeit nicht so viel bedeutete, wie einen Freund zu haben, der seine Hand hielt, wenn er starb“. Ein Trost, den Tildens Tod 17 Jahre zuvor verhindert hat.