KI-Suchergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen – das gilt auch für das neue ChatGPT 5. Steffen Haubner erklärt, wie man KI richtig nutzt.
Auch bei KI eigenständig denkenSo nutzt man ChatGPT und Co. richtig
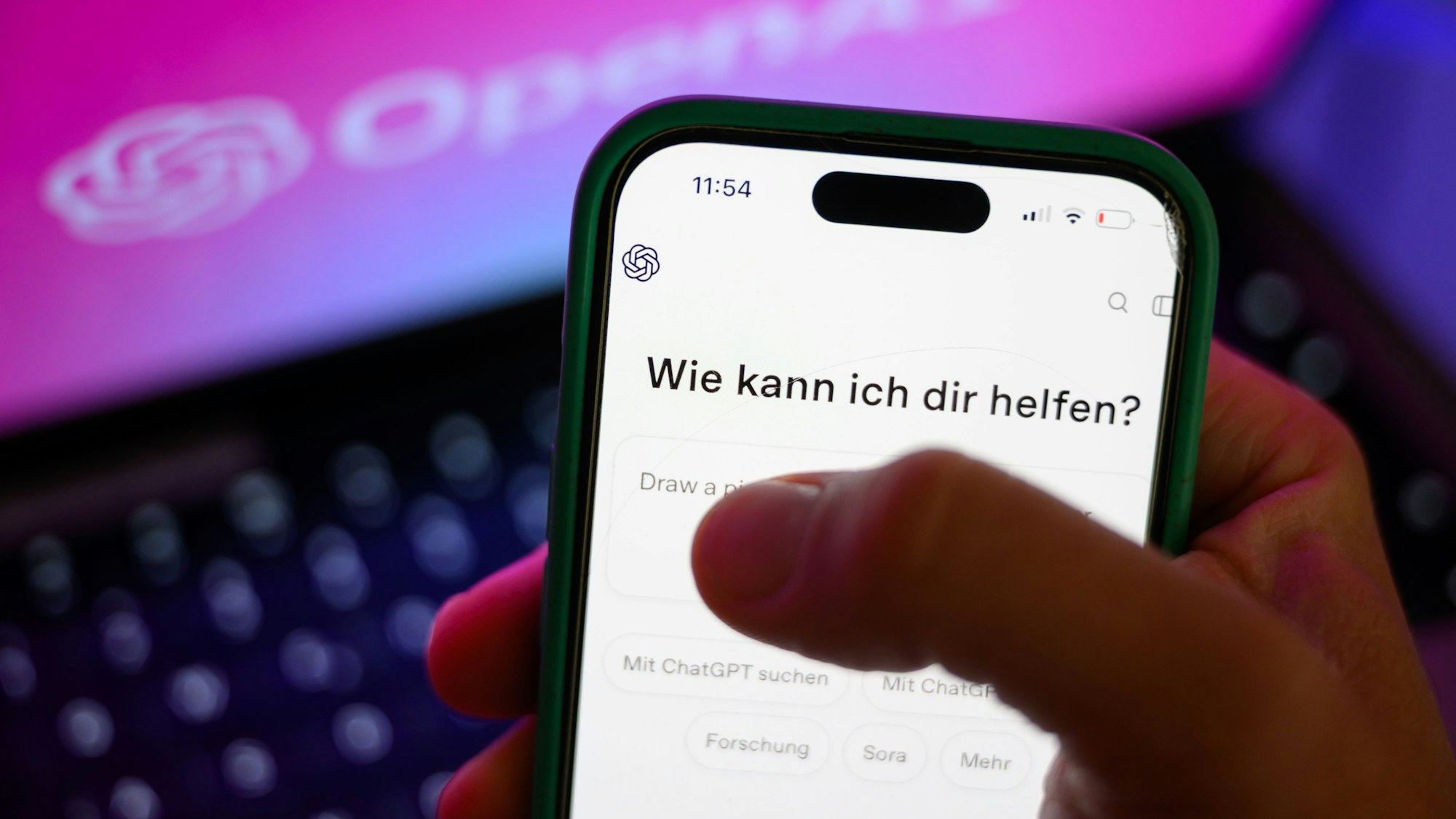
Bei der Nutzung von ChatGPT sollte man sich nicht nur auf die Ergebnisse der KI verlassen.
Copyright: Hendrik Schmidt/dpa
Wer mehrere sogenannte Chatbots – Computerprogramme, die Gespräche mit menschlichen Endbenutzern simulieren – parallel nutzt und die Ergebnisse vergleicht, macht schnell die Erfahrung, dass die Antworten teilweise drastisch voneinander abweichen. Nun ist vieles eine Sache der Interpretation und nicht auf jede Frage haben ChatGPT & Co. eine Antwort. Wie könnte das auch sein, denn man muss sich immer vergegenwärtigen, dass auch KI nur auf Basis dessen arbeiten kann, was Menschen an Wissen und zusammengetragen haben.
Trotzdem bekommt man etwa auf die Frage, wie viele Spezies ausgestorben sind, seit der Mensch die Erde besiedelt, Antworten, die zwischen Millionen und Milliarden schwanken. Das passiert sogar beim gleichen Chatbot, wenn man die Frage etwas anders formuliert oder sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten stellt. Die Gründe dafür können selbst KI-Experten nur ansatzweise erklären.
Grundsätzlich sollte man jedenfalls sehr vorsichtig damit sein, ChatGPT, Perplexity, Gemini oder Lumo, das ich hier vergangene Woche als europäische Alternative vorgestellt habe, wie ein klassisches Nachschlagewerk oder eine Google-Suche zu benutzen. Grundsätzlich sollten Sie immer die Ergebnisse mehrerer KI-Anbieter miteinander vergleichen, den Quellen – so sie denn angegeben werden – nachgehen und zusätzlich möglichst klassische Medien wie Lexika, Sachbücher und Fachartikel heranziehen.
ChatGPT: Die Frage richtig stellen
Viel hängt davon ab, wie man eine Frage oder Aufgabe – im Fachjargon spricht man von einem „Prompt“ – formuliert und was man als Ergebnis erwartet. Schließlich kann man KI nicht nur für Informationen nutzen, sondern unter anderem auch, um Grafiken zu erstellen, Musik zu komponieren, Berechnungen anzustellen oder Software zu programmieren. Auch hier ist Vorsicht geboten. Bittet man etwa ChatGPT, Zahlen aus einem hochgeladenen Dokument in ein Diagramm zu übertragen, so kann es durchaus sein, dass sich die KI einfach selbst Zahlen ausdenkt. Das kann, etwa bei einer Präsentation, ziemlich peinlich werden. Auch vermeintliche Quellenangaben sind mitunter rein fiktiv.
Wie geht man mit diesen Problemen um und welche Mittel gibt es, um zu besseren Ergebnissen zu kommen? Von Leserinnen und Lesern, aber auch von Seiten der Redaktion, höre ich immer wieder, dass ChatGPT am häufigsten eingesetzt wird und das größte Vertrauen genießt. In einer unregelmäßigen Reihe von Beiträgen zum Thema KI-Nutzung möchte ich mich daher auf ChatGPT konzentrieren, ohne die Alternativen außer Acht zu lassen. Da 23 Euro pro Monat – so viel kostet ChatGPT Plus – für die meisten von uns viel Geld sind, werde ich mich primär auf die Gratis-Version beziehen und nur ab und zu darauf eingehen, wo es Unterschiede zur kostenpflichtigen Version und zu anderen Anbietern gibt.
GPT-5 und GPT-5 Thinking: Das sind die Unterschiede
Die neueste Version des Chatbots von OpenAI ist seit kurzem verfügbar und heißt ChatGPT 5. Dahinter steht ein neues Sprachmodell namens GPT-5, das als derzeit leistungsstärkstes seiner Art gilt. An dieser Stelle muss ich leider etwas technischer werden. Zu unterscheiden ist nämlich zwischen GPT-5 und GPT-5 Thinking. Der Unterschied liegt im sogenannten Reasoning. Vereinfacht ausgedrückt: Die „Thinking“-Version vollzieht sorgfältigere Erwägungen und braucht dafür mehr Zeit. Man muss dazu auch wissen, dass ChatGPT trotz der oberflächlichen Unterscheidung in zwei Sprachmodelle tatsächlich viele unterschiedliche Sprachmodelle nutzt. Dabei gibt es komplexere und eher einfach gestrickte. Je nach Inhalt und Formulierung der Ausgangsfrage entscheidet die KI, wohin genau sie geleitet wird.
Damit erklären sich zum Teil auch die erwähnten Unterschiede bei den Antworten. Dass der Anbieter OpenAI sich nicht in die Karten schauen lässt, wie genau dieses sogenannte Routing eigentlich abläuft, macht die Sache nicht einfacher. Tatsache ist, dass sowohl die Gratis-Version als auch ChatGPT Plus auf GPT-5 und GPT-5 Thinking zurückgreifen. Wer bezahlt, hat aber Anspruch auf schnellere, besser analysierte Antworten, kann mehr Anfragen stellen, mehr Grafiken erzeugen lassen und mehr Dokumente hochladen, um sie von der KI verarbeiten zu lassen.
Wenn Sie mit der Gratis-Version arbeiten, können Sie sich behelfen, indem Sie Ihren Prompt klarer formulieren. Lassen Sie Formalitäten wie „Bitte“ oder „Kannst du“ weg und schreiben Sie stattdessen zum Beispiel: „Wie viele Tierspezies sind seit Existenz des Homo sapiens auf der Erde ausgestorben und wie viele sind es pro Jahr? Denke gut über die Antwort nach, präzise Zahlen sind mir sehr wichtig. Stelle diese zusätzlich in einem grafischen Diagramm dar und liefere Quellenangaben zu real existierenden Publikationen zu diesem Thema.“ Bei wichtigen Fragen, etwa bei der Recherche für einen Vortrag, konsultieren Sie weitere Chatbots, vergleichen die Antworten und gehen Sie den Quellen nach. Auch in Zeiten von KI ist eigenständiges Denken eben noch nicht überflüssig geworden.

