Während Boomer, Millennials und Gen-Z lautstark ihre Interessen vertreten, bleiben die heutigen 50-Somethings merkwürdig still – obwohl ihnen die wohl schlechtesten Renten der Nachkriegszeit drohen.
Die VergessenenWarum die Generation X zwischen allen Stühlen sitzt
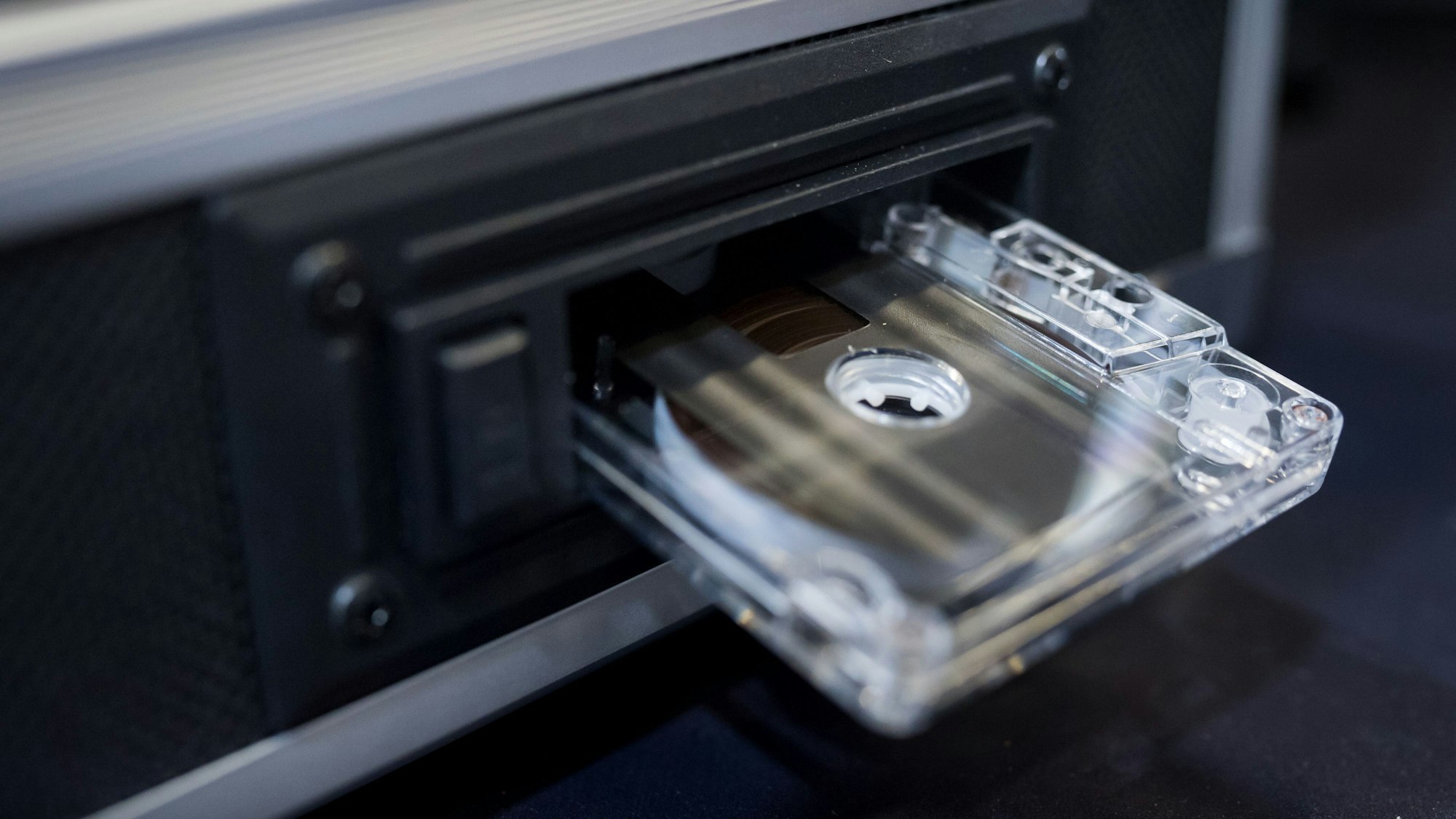
Das Medium der Generation X: Mit der Kassette liegen sie auch damit zwischen den Schallplatten der Boomer und den digitalisierten MP3-Playern der Millennials.
Copyright: Alexander Heinl/dpa-tmn
Die Marotten der Boomer, Millennials, der Gen-Z sind in den vergangenen Jahren oft und ausführlich thematisiert worden, auch von mir. Nur eine Frage hat sich mir dabei so gut wie nie gestellt: Wieso kommt in dem Reigen eine Altersgruppe so gut wie nie vor? Die zwischen den Boomern und den Millennials. Die Jahrgänge 1965 bis 1980. Meine Generation. Die Generation X.
Das „X“ im Namen trägt eine gewisse Nicht-Existenz, ein Platzhaltertum bereits in sich. Das liegt daran, dass der Begriff aus dem gleichnamigen Roman von Douglas Coupland stammt. Er erzählt von drei jungen Leuten, die sich aus der Welt, die sie umgab, in die kalifornische Wüste zurückgezogen haben, wo sie Gelegenheitsjobs nachgehen und sich Geschichten erzählen.
Generation X sind demnach die, die lange keinen guten und richtigen Platz in der Gesellschaft hatten. Damit hat das Buch frühzeitig den Nagel auf den Kopf getroffen. Das zeigt ein Bericht des „Economist“ von vor einigen Monaten. In dem hat die britische Zeitschrift Zahlen aus der halben Welt zusammengetragen und ausgewertet, die zeigen, dass die heutigen 50-Somethings die „wahren Verlierer“ bei fast allem sind.
Die Millennials sind heute oft ihre Vorgesetzten
Sie haben, als sie jung waren, im kapitalistisch organisierten Teil der Welt schlecht verdient, weil es wenig Jobs gab. Sie haben keine Karrieren gestartet, weil vor ihnen zu oft die nur wenige Jahre älteren Boomer noch aktiv waren. Sie wurden zugleich von unten von ehrgeizigen Millennials be- und verdrängt, die heute oftmals ihre Vorgesetzten sind. Die Dotcom-Krise platzte der Generation X in ersten Versuchen, am Aktienmarkt zu Geld zu kommen. Die Finanz- und Bankenkrise 2009 platzte ihnen mitten in die Lebensphase, in der für gewöhnlich Immobilienkäufe geplant und Kredite gebraucht werden.
Und jetzt, da die ersten von ihnen 60 Jahre alt werden und in das Jahrzehnt einsteigen, in dem Ruhestand und Altersfreizeit nahen, erweisen sich die Rentenversicherungssysteme, in die sie jahrzehntelang brav eingezahlt haben, an die sie auch geglaubt haben, als marode.
Aktuell ist schon eine „Haltelinie“ von 48 Prozent bis 2031 der Jungen Union zu viel des Guten. Und die Gen-X geht erst ab dem Jahr danach überhaupt in Rente. Änderungen zum Schlechten zeichnen sich also ab, dabei sind die Erwartungen schon heute noch groß: Knapp die Hälfte der Generation-X-ler geht davon aus, sich im Alter einschränken, weiterarbeiten oder in etwas Billigeres umziehen zu müssen.
Also wird ihre Generation vielleicht schon deshalb ignoriert, weil das Hinschauen zu furchtbar wäre? Verlierer sind insgesamt kein schöner Anblick. Und noch schlimmer wird es, wenn die Gruppe der Verlierer sich als groß erweist.
Und so sieht es aus: Zur Generation X gehören laut offizieller Statistik aktuell 16,55 Millionen Menschen in Deutschland. Platz zwei belegen die Millennials mit 16,25 Millionen. Gen-Z ist auf Platz drei mit 12,33 Millionen. Boomer gibt es demnach nur 12,17 Millionen.
Wenn es aber beim Thema Rente um zusätzliche Belastungen, Einschränkungen und Zumutungen geht, schlagen immer nur diejenigen auf den Plätzen zwei, drei und vier Krach. Wo bleibt der Aufschrei der Generation X? Oder sehen sie die Not nicht und vertrauen sie weiter darauf, dass es schon irgendwie werden wird? Wie es – bisher – ja noch immer irgendwie geworden ist: Tschernobyl hat die Welt nicht verseucht, der Kalte Krieg hat sich vorübergehend selbst abgeschafft, die Mauer fiel, ohne dass man selbst etwas tun musste.
Ähnliche Problemschrumpfungen gab es auch im Kleinen. Die Jahrgänge 1965 bis 1980 waren oft überzählig, egal, wo sie hinkamen. Die Klassenräume und Hörsäle waren randvoll, die Praktikumsplätze längst vergeben, die Jobs besetzt. Ist das „Bewerbungstraining“ eigentlich eine Erfindung der arbeitssuchenden Gen-X?
Auf der Diskussionsplattform Reddit schreibt ein User, das Bild, auf das sich die Generation X am besten vereinigen lasse, sei das der „Schlüsselkinder“: jene ungezählten Minderjährigen, deren Eltern arbeiten waren, wenn die Schule aus war. Die sich selbst managten: Essen und Hausaufgaben machen, zum Sportverein oder Musikunterricht gehen, Zimmer aufräumen, Freunde treffen, Haustiere versorgen.
Generation X: Das klassische Mittelkind
Die Generation X sei ein „klassisches Mittelkind“, hat das Portal familie.de mal geschrieben. Auch so lässt sich eine hohe Chance, zwischen allen Stühlen zu Boden zu gehen und übersehen zu werden, gut beschreiben. Und auch das erklärt, dass die Generation nach der Platznot in ihrer Erwachsenwerdung später dann auf Anpassung an Umstände bedacht war, aufs Nicht-Auffallen, ihren Kram machen, unbehelligt bleiben.
Vielleicht haben ihre Zugehörigen dabei versäumt, sich große Ziele zu setzen. Man wollte gut über die Runden kommen, das reichte. Weltherrschaft interessierte erst die später Geborenen. Dieser Mangel an Ehrgeiz war auch sympathisch und brachte Rumhänger-Filme wie „Slacker“ hervor. Er ließ auch Millionen Menschen zufrieden grinsen, wenn sie im Buch von Douglas Coupland an die Stelle kamen, wo Ich-Erzähler Andrew in „Generation X“ den Häuserkauf zum „Todeskuss“ für die Käufer erklärt.
„Wenn dir Leute erzählen, sie hätten sich ein Haus gekauft, können sie dir ebenso gut mitteilen, sie besäßen keine Persönlichkeit mehr“, sagt er da. Weil das heiße, „dass sie in einem Job eingesperrt sind, den sie hassen“, dass sie „jeden Abend damit verbringen, Videos anzusehen; dass sie 15 Pfund Übergewicht haben; dass sie keiner neuen Idee mehr zuhören“.
Diese kulturell geadelten Vorbehalte gegen Besitz und materielle Eigenverantwortung ließen sich jahrelang gut leben. Echter Handlungsdruck bestand nicht. Man wohnte zur Miete, ging geregelt arbeiten, zahlte seine Sozialversicherungsabgaben und wollte ansonsten von Vermögensaufbauplänen und dergleichen möglichst nichts wissen.
Vertrauen in den Staat
So blieb die Generation X vielleicht die Gruppe, in der Vertrauen in den Staat und den Fortbestand der geregelten Verhältnisse am ausgeprägtesten war. Auch wenn man sich heute lustig macht über den Sichere-Renten-Spruch von Norbert Blüm anno 1986, fand er doch Gehör. Es war zudem praktisch, daran zu glauben. So musste man sich nicht selbst kümmern und konnte die Rente getrost zum Thema für fernere Tage erklären.
„Wir sind groß geworden mit dem Gedanken, dass Loyalität und Leistung belohnt werden – oft bis zur Selbstaufgabe“, hat Karrierecoachin Sabine Votteler kürzlich im Tagesspiegel die Arbeitseinstellung der Generation X, zu der sie auch selbst gehört, beschrieben. Das klingt rührend naiv. Ganz so, als hätten da welche an die Seele des Kapitalismus geglaubt. Der hat aber keine. So gesehen verwundert es nicht, wenn Geldanlage-Experten heute melden: „Generation X schlecht vorbereitet auf den Ruhestand“, sie habe überzogene Erwartungen und zu wenig Know-how.
Eher wundert man sich über das Entsetzen mancher 50-Somethings, wenn sie im viel zu spät anberaumten Rentenaufklärungsgespräch lernen mussten, dass die Auszahlungssumme, die ihnen Jahr für Jahr im Rentenbescheid für den Ruhestand avisiert wurde, eine Fantasiezahl ist, von der Steuern und Versicherungen in eklatanten Größenordnungen abgezogen werden, sodass wenig übrigbleibt. Und über ihre Verblüffung darüber, dass das eben noch verhöhnte Wohneigentum plötzlich als Mindestausstattung für gutes Leben gilt.
Auf immer in der kalifornischen Wüste?
Und über die staunende Ehrfurcht, mit der sie, sofern Eltern geworden, ihren Kindern dabei zuschauen, wie die jeden verdienten Euro in ETFs investieren, um „für später“ vorzusorgen. Natürlich ohne sich selbst deshalb auch zu solchen Geldmehrungsanstrengungen aufgerufen zu fühlen.
So mancher aus der Generation X scheint noch immer in der kalifornischen Wüste zu sein und auf die nächste interessante Geschichte zu warten. Das ist mit Ende 50, demnächst 60 vielleicht ein bisschen lächerlich und in der Masse für die ganze Gesellschaft möglicherweise auch eine Bedrohung.
Aber irgendwo in diesem Setting steckt vielleicht – oder sollte man besser sagen: hoffentlich – auch noch ein gewisser unverwüstlicher Grundoptimismus. Aus dem könnte man, zumal in diesen pessimistischen Zeiten, etwas machen. Und wenn es für den Anfang eine Geschichte darüber ist, wie man bei düsteren Aussichten nicht völlig verzweifelt.
Dieser Text erschien zuerst im Tagesspiegel.
