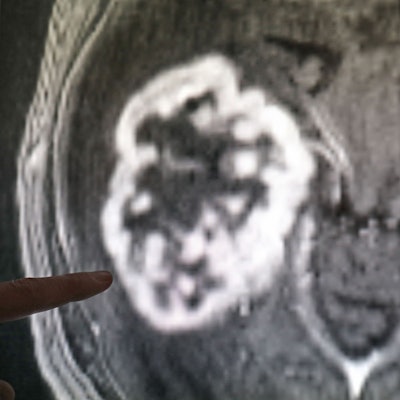Mit 40 bekam Nejla Sert die Schockdiagnose. Seit vergangenem Jahr gilt sie als geheilt. Mit ihrer Geschichte will sie nun Mut machen.
Weltkrebstag„Ich wollte mein Kind in der Kita erleben“ – Kölnerin überlebt Darmkrebs

Nejla Sert und ihr Arzt Dr. Bernhard Sibbing im Krankenhaus Holweide, wo die Kölnerin behandelt wurde.
Copyright: Meike Böschemeyer
Als Nejla Sert das erste Mal zwischen Krebserkrankten sitzt, weiß sie noch nichts von dem zehn Zentimeter großen Tumor in ihrem Bauch. Ihr Hausarzt hat die damals 40-Jährige für eine Infusion in eine onkologische Praxis geschickt, weil ihm die Räumlichkeiten für eine solche Behandlung fehlen. Seit Monaten hat sie Schmerzen und nimmt ab, doch der Mediziner fand nichts außer einem Eisenmangel. Während neben ihr Patienten in den gepolsterten Stühlen sitzen und die Chemotherapie durch sie hindurchläuft, bekommt Sert also Eisen verabreicht. „Bei diesem Anblick habe ich mir noch gedacht, dass ich ja froh sein kann, weil es Schlimmeres gibt.“
Die Mutter eines damals anderthalbjährigen Sohnes bekommt die Diagnose Darmkrebs nur einige Wochen später. Ein Zufallsbefund. Es war letztlich nur eine einzige Ultraschalluntersuchung, die all die Monate voller Beschwerden gefehlt hatte. Die Industriekauffrau war schließlich beim Urologen gelandet, weil ihr Vater Nierensteine vermutete, die in der Familie liegen. „Hatten Sie diesen Knubbel schon immer?“, fragte der Arzt sie und schickte sie sofort in die Notaufnahme ins Krankenhaus Holweide.
Als sie dort am nächsten Tag nach zahlreichen Untersuchungen im Besprechungszimmer auf Ergebnisse wartet, hat die Kölnerin „immer noch keinen blassen Schimmer. Ich dachte vielleicht an eine Zyste.“ Das Stichwort Krebs war bisher noch nicht gefallen. In dem Moment, als es doch fällt, passt Serts Ehemann auf den gemeinsamen Sohn auf – der Kleine macht gerade einen Mittagsschlaf.

Auch eine große Portion Glück habe laut Dr. Sibbing zur Genesung seiner Patientin geführt.
Copyright: Meike Böschemeyer
„Ich habe erstmal eine Runde geheult“, erinnert sich die heute 46-Jährige. Dann ruft sie ihren Mann an. Als die Nachricht nach Momenten der Ungläubigkeit zu ihm durchdringt, weist sie ihn an: „Weck unseren Sohn bloß nicht auf. Er soll in Ruhe weiterschlafen. Wenn er aufwacht, verhältst du dich normal, ziehst ihn an, und dann könnt ihr kommen.“
Heute – rund sechs Jahre später – sitzt Sert nicht mehr als Patientin im Krankenhaus Holweide. Denn die Kölnerin gilt als geheilt. Zum Weltkrebstag, der jährlich am 4. Februar stattfindet, erzählt sie von ihrem Weg: „Wenn ich nur einer anderen Person Mut machen kann, ist das schon viel wert.“
Mit festen Schritten läuft die Kölnerin durch den Flur der onkologischen Ambulanz zu einem Besprechungszimmer, um sich für die Rundschau zum Gespräch mit ihrem ehemaligen Arzt zu treffen. „Es ist für mich nicht schlimm, wieder herzukommen. Es liegt für mich in der Vergangenheit, und es ist abgehakt“, sagt sie und lächelt.
Krebs kehrt nach erster Operation zurück
Bis zu diesem Lächeln war es ein holpriger Weg. Denn nur fünf Monate nach der ersten Operation, durch die der Tumor entfernt wurde, wartet „eine zweite Hiobsbotschaft“ auf die Kölnerin. Der Krebs ist zurück und hat Metastasen, also Ableger des ursprünglichen Tumors, an der Leber gebildet. „Das war nochmal ein Schlag ins Gesicht“, erinnert sie sich. Zeit für einen Schock bleibt keine. „Ich brauchte eine Chemotherapie, und alles musste sehr schnell gehen. Damals dachte ich, dass es nun einfach so ist, und gemacht werden muss.“
Dr. Bernhard Sibbing, Leiter der Sektion Gastrointestinale Onkologie, überbringt Sert diese Nachricht. Damals ist er sich nicht sicher, ob die Mutter geheilt werden kann. „Patienten mit Darmkrebs, bei denen Metastasen festgestellt werden, haben nach deren Entfernung eine Wahrscheinlichkeit zwischen 50 und 80 Prozent dafür, dass der Krebs ein zweites Mal wiederkommt“, erklärt der Mediziner.
„Es ist also eine ordentliche Portion Glück dabei, dass Frau Sert geheilt ist. Und weil ihre Erkrankung schon viele Jahre her ist, bleibt sie mit großer Wahrscheinlichkeit geheilt.“ Laut dem Arzt könnten auch Serts positive Grundeinstellung und die Unterstützung ihrer Angehörigen eine große Rolle bei der Heilung gespielt haben. „Ich war schon immer ein optimistischer Mensch“, sagt sie. „Und meine Familie war sofort da und hat mich gepflegt. Meine größte Energiequelle war aber mein Sohn.“

In der Onkologischen Ambulanz des Krankenhauses Holweide erhielt Nejla Sert ihre Chemotherapie. Dabei fühlte sie sich sehr gut aufgehoben und ist der Belegschaft dankbar.
Copyright: Meike Böschemeyer
Ihre Chemotherapie bekam die Mutter alle zwei Wochen und insgesamt sechsmal. „Über eine kleine Pumpe, die an einem Zugang an der Brust befestigt war, konnte die Verabreichung teils auch zuhause automatisch erfolgen. Der Rest passierte hier in der Ambulanz“, erklärt Dr. Sibbing. An diese Zeit der Chemotherapie kann sich seine Patientin nur noch in Fragmenten erinnern.
„Ich stand unter starken Schmerzmitteln und habe fast nur geschlafen“, erzählt sie von den heftigsten Tagen. „Es hat sich angefühlt, als würde jemand einen Benzinkanister in meinem Darm ausleeren und ihn dann mit dem Feuerzeug anzünden. Ich musste einfach irgendwie überleben.“ Laut Dr. Sibbing kommen solch starke Schmerzen nicht oft vor. Häufige Nebenwirkungen sind hingegen „Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle oder Abgeschlagenheit“.
Ihr Sohn gibt der Kölnerin Kraft
Serts kleiner Sohn besucht seine Mutter in dieser Zeit ab und an im Schlafzimmer. „Wenn ich geschlafen habe, hat er meine Haare gestreichelt und mir ein Küsschen gegeben“, wie ihr Mann ihr erzählte. Was seine Mutter genau hat, kann das Kind damals noch nicht verstehen. Seine Familie kümmert sich intensiv um ihn, „aber er hat natürlich gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Vor allem, weil er seine Mutter so selten sehen konnte.“
Nach der Chemotherapie steht der Kölnerin eine weitere Operation bevor, in der die Metastasen entfernt werden. „Die Chemotherapie hat in dem Fall so außergewöhnlich gut gewirkt, dass kein vitales Tumorgewebe mehr gefunden wurde“, sagt Dr. Sibbing. „Wir hatten danach darüber gesprochen, ob zur Sicherheit noch eine weitere Chemotherapie durchgeführt wird.“ Sert entscheidet sich dagegen. „Mein Kind kam in die Kita und als seine Mutter wollte diesen ersten Tag nicht verpassen.“
Darmkrebs-Betroffene werden laut Kölner Arzt jünger
Fünf Jahre nach ihrem ersten Befund, also im Dezember 2025, gilt die Kölnerin dann offiziell als geheilt. Bei der halbjährlichen Nachkontrolle wird erneut nichts gefunden. Auch für Dr. Sibbing ist das ein außerordentlich schöner Moment: „Es kommt nicht so häufig vor, dass man so einen positiven Verlauf hat. Und das ist ganz toll, wenn man das dann miterleben kann“, sagt er. Der Arzt betont die Relevanz von Vorsorgeuntersuchungen (siehe Infotext).
Man sollte auch auf Symptome achten, hinter denen Darmkrebs stecken könnte. Dazu gehören laut Dr. Sibbing unter anderem Schmerzen, Stuhlunregelmäßigkeiten, Blut im Stuhl und ungewollter Gewichtsverlust. Eine Entwicklung beobachtet er mit Sorge: „Ich habe immer mehr jüngere Darmkrebspatienten, also Personen, die unter 50 Jahre alt sind. Die jüngste Person war Anfang 40. Warum das so ist, weiß man noch nicht.“
Betroffenen einer Krebsdiagnose rät Sert: „Dagegen ankämpfen bringt nichts. Es ist wichtig, die Diagnose zu akzeptieren und sich nicht ständig zu fragen ‚Warum ich?‘. Das raubt einem nur Energie. Und dann gilt es, Mut und Vertrauen zu haben. Vertrauen in die Ärzte, die Therapie und sich selbst.“
Die Kölnerin ist mittlerweile wieder ganz in der Normalität angekommen. Sie arbeitet weiter als Industriekauffrau und kann Sport machen. Außer einer Diabetes-Erkrankung, die entstand, weil ihr bei der ersten OP zur Sicherheit auch ein Teil ihrer Bauchspeicheldrüse entfernt wurde, hat sie keine gesundheitlichen Folgen. Etwas hat sich jedoch stark verändert: „Ich nehme die positiven Sachen noch stärker wahr. Ich bin verrückter und noch mutiger, weil ich weiß, wie schnell das Leben vorbei sein kann. “
Als Sert das Krankenhaus Holweide verlässt, läuft sie nicht direkt zum Parkhaus, um weiter zu hetzen. Sie hat absichtlich außerhalb geparkt, und einen Spaziergang durchs Grüne eingeplant. „Solche kleinen Momente mit ein bisschen Bewegung habe ich während meiner Erkrankung nämlich oft vermisst.“