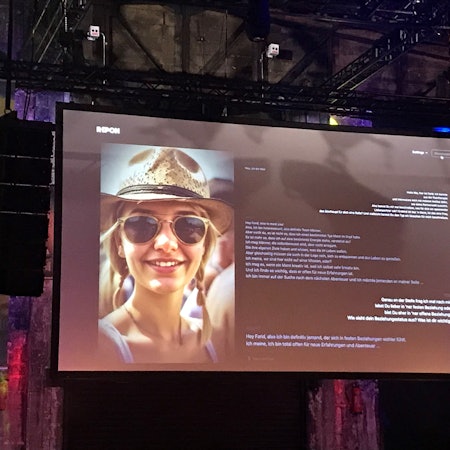Stephan Grünewald vom rheingold-Institut beschäftigt sich in seinem neuen Buch mit den Folgen der aktuellen Krisenlagen für unsere Gesellschaft. Im Interview mit der Kölnischen Rundschau erläutert er seine Erkenntnisse.
Kölner Autor Stephan Grünewald„Viele Menschen ziehen sich in ihr privates Schneckenhaus zurück“

Aktuelle Krisenlagen in der Welt und Konflikte im persönlichen Alltag belasten viele Menschen.
Copyright: dpa
Herr Grünewald, sind wir aktuell in einer historisch besonders heftigen globalen Krisenlage?
Krisenlagen gab es in der Geschichte immer. Das Besondere der jetzigen Situation ist die Häufung von vielen globalen Krisen, die zudem aus Sicht der Leute zu ewigen Wiedergängern werden – verbunden mit dem starken Gefühl, dass wir diese nicht in den Griff bekommen.
Wie wirken sich diese Ereignisse auf unsere Gesellschaft aus?
Alles zum Thema Netflix
- Spannende Netflix-Serie „Hostage“ Aug' in Aug' mit der Lieblingsfeindin
- Netflix, Prime, Disney & Co. Diese Highlights bringt der Streaming-Herbst
- Starbesetzte Verfilmung „The Thursday Murder Club“ erreicht nicht die Erwartungen
- Familienoberhaupt und kriminelle Geschäfte Maria Bello brilliert als Clansmutter in Netflix-Serie „Waterfront“
- Erfolgreichster Netflix-Film „KPop Demon Hunters“ erreicht mehr als 236 Millionen Abrufe
- Rekorde bei Netflix Serie „Wednesday“ verzeichnet in wenigen Tagen fast 80 Millionen Abrufe
- Soziale Medien Leerer Blick junger Leute – was ist am „Gen Z Stare“ dran?
Viele Menschen ziehen sich in ihr privates „Schneckenhaus“ zurück, sprich in ihre eigene kleine Welt, die man noch im Griff hat, in der man sich halbwegs wohlfühlen kann, und spannen gleichzeitig einen Verdrängungsvorhang vor die Welt da draußen. Unsere Befragten beschreiben uns, dass sie bewusst weniger Nachrichten gucken, weniger Zeitung lesen und damit die schlechten Meldungen ausblenden. Stattdessen schauen viele lieber unterhaltsame Netflix-Serien, weil sie dort vertrauten Charakteren folgen können.
Ist das ein normales menschliches Verhalten?
Ja, Verdrängung ist sehr menschlich. Allerdings ist dieser beschriebene „Vorhang“ nicht komplett dicht. Die Folgen der äußeren Krisen für den Alltag wie Inflation, Aggressivität oder die desolate Infrastruktur schimmern hindurch und werden von den Leuten trotzdem wahrgenommen. Das führt dazu, dass diese Dinge nicht aus der Welt sind, sondern seltsam diffus und gruselig nachwirken.
Wer leidet eigentlich besonders?
Es sind vor allem die jungen Leute. Sie merken, dass Ihnen möglicherweise die Zukunft wegbricht. Sie fragen sich: Werde ich eine sichere Rente haben? Werde ich mir Wohneigentum oder bezahlbaren Wohnraum gerade in den Großstädten leisten können? Zudem bekommen sie mit, dass Deutschland kein florierendes Land mehr ist. Ein weiteres Phänomen ist, dass ihre Zukunftssorgen in der eigenen Generation nicht mehr aufgefangen werden. Unsere Jugendstudie hat ergeben: Wir haben keinen Generationskonflikt, sondern vielmehr einen Konflikt innerhalb der jungen Generation.
Was ist damit gemeint?
Der Konflikt liegt darin, dass junge Leute, die viel in den Sozialen Medien unterwegs sind, merken, dass sie ständig Gefahr laufen, gedisst, gecancelt oder fies kommentiert zu werden, wenn sie sich zu etwas in den Online-Foren äußern. Das führt bei vielen zu einer Art Tarnkappenstrategie – sprich junge Menschen scheuen, was sie eigentlich immer gemacht haben, nämlich klare Positionen zu beziehen. Hinzu kommt die belastende Situation in vielen Familien. Die Kinder und Jugendlichen haben heute keine Angst mehr vor autoritären Vätern, die sie drangsalieren, sondern dass die eigene Familie auseinanderbricht, weil die Eltern sich trennen oder Patchwork-Familien nicht mehr funktionieren, wenn es zu viel Stress zu Hause gibt. Das führt mitunter dazu, dass die rebellische Phase in der Pubertät ausfällt. Die dadurch gestaute Ausdrucksbildung kann bei jungen Menschen zu Unruhezuständen, Schlafstörungen und depressiven Symptomen führen. Das haben unsere Befragungen erschreckenderweise ergeben.

Rheingold-Institut-Gründer Stephan Grünewald im Interview.
Copyright: dpa
Inwieweit spielt ein überzogener Medienkonsum hier eine Rolle?
Die beschriebenen psychosomatischen Symptome können sich dadurch verstärken. Speziell in der Corona-Zeit haben viele Jugendliche verlernt, wie man sozial interagiert. Sie wurden damals mehr oder weniger dazu gezwungen, nur noch medial in Kontakt zu treten. Zudem haben sie ihre Sorgen durch Unterhaltungsmedien wie exzessives Schauen von Netflix-Serien oder Gaming-Aktivitäten an die Seite gedrängt. Ich nenne das auch Affekt-Masturbation. Diese Blitzableiter-Funktionalität kann sich auch politisch auswirken. Dass die AfD oder die Linken bei jungen Menschen besonders erfolgreich sind, hängt auch damit zusammen, dass diese Parteien einfach mal „einen raushauen“, öffentlich wütend sind. Das kommt bei einem Teil der jungen Leute gut an.
Können Krisen dann auch etwas Positives auslösen? Grundsätzlich sind Menschen ja anpassungsfähige Wesen.
Wenn wir mal den Blick von den jungen Menschen weiten auf alle Altersklassen, dann kann man das vor allem in der Zeit der Ohnmachtserfahrung der Corona-Krise beispielhaft erkennen. Es war bewundernswert, wie die Leute sich selbst stabilisiert haben. Das Hamstern damals war für den einzelnen im Grunde ein Symbol dafür, dass „ich handlungsfähig bin“. Auch der „Sturm“ auf die Baumärkte, um sich mit Werkzeug auszustatten, um zu Hause etwas bauen oder reparieren zu können, hatte die Qualität der persönlichen Ohnmachtsabwehr. Auf diese unbewussten Strategien gehe ich in meinem Buch ausführlich ein.
Und was hat dieses unbewusste Verhalten nachhaltig für unsere Krisenfestigkeit gebracht?
Zunächst einmal eine gewisse Zuversicht: Verdammt noch mal, wir kommen sogar mit einer solch massiven Krise klar! Leider ist dieses Gefühl politisch nicht generell umgemünzt und genutzt worden. Es gab eine rühmliche Ausnahme: die Energie-Krise am Anfang der Ampel-Regierung. Das Bedrohungsszenario war groß: Wenn wir jetzt nicht alle Energie sparen, dann sitzen wir im Winter im kalten „Schneckenhaus“, können kein Fernsehgucken, weil wir Blackouts haben. Das hat dazu geführt, dass alle an einem Strang gezogen haben – die Bürger, die Industrie und die Politik durch die schnelle Einrichtung neuer LNG-Gas-Terminals. Durch die kollektive Selbstwirksamkeit haben wir die Krise meistern können.
Was müsste speziell die Politik leisten, damit die Bürger unserer krisenhaften Welt trotzen?
Wir brauchen Handlungsdirektiven seitens der Regierenden und den politischen Willen, den Menschen schonungslos die Wahrheit über die Lage zu sagen und dann die Wege aufzuzeigen, wie wir gemeinsam aus der Krise herauskommen. Leider passiert das aktuell nicht – oder viel zu wenig.
Wenn die Politik ausfällt, wer könnte einspringen und helfen?
Die Bürger vertrauen im Moment vermutlich der Wirtschaft mehr als der Politik. Das bekommen wir in unseren Befragungen der Menschen mit. Die Losung könnte sein: Wenn es die Politik nicht schafft, dann können es möglicherweise die Arbeitgeber machen, indem sie Korpsgeist in den Unternehmen beschwören und jenseits von abstrakten Quartalszahlen sinnvolle Ziele und Gemeinsamkeit ausrufen. Kritisch in diesem Zusammenhang ist allerdings der Trend zum vermehrten Homeoffice, wodurch Teamstrukturen dann auch ein Stück weit geschreddert werden können, weil sich die Angestellten in ihrer Komfortzone zu Hause immer mehr von ihrem Arbeitgeber entfremden. Ich plädiere daher dafür, dass Arbeitgeber Vorgaben machen, Homeoffice maximal an zwei Tagen zu erlauben und an zwei von drei Tagen die Präsenzpflicht für alle einzufordern. Für den Zusammenhalt ist das extrem wichtig.
Was kann man sonst noch tun, um die Menschen wieder mehr zusammenzubringen?
Es fängt im öffentlichen Raum in den Städten und Gemeinden an. Wir brauchen viel mehr Begegnungsräume, also Plätze, an denen die Menschen sicher und zwanglos zusammenkommen und kommunizieren können. Schulen sollten vielmehr auf Diskussionsforen und Gesprächstage setzen, Exkursionen und Klassenfahrten anbieten. Zudem bin ich sehr für ein soziales Pflichtjahr, weil dies den Effekt hat, dass junge Menschen aus ihrer Komfortzone herauskommen und mit bisher fremden Leuten zusammenarbeiten müssen und damit andere Lebenswirklichkeiten kennenlernen.
Zum Schluss noch die Frage, warum Sie den ungewöhnlichen Begriff „Krisenakrobaten“ im Titel Ihres neuen Buches verwenden.
Die Idee ist aus den Ergebnissen unserer „Zuversichts-Studie“ erwachsen. Wir haben festgestellt, dass trotz der vielen Krisen, die Leute überraschende Formen von Selbstwirksamkeit und Resilienz entwickelt haben. Danach schauten 87 Prozent der Befragten privat zuversichtlich in die Zukunft. Ich beschreibe daher anschaulich die Strategien, mit denen sich die Menschen in Krisenzeiten stabilisieren und zeige auf, wie man diese Strategien auf die Gesellschaft übertragen kann.