Alle motzen über Bürokratie, vor allem Politiker: Wer im Tagesgeschäft punkten will, fordert lautstark den Abbau von Vorschriften und Verwaltung. Oft aber ist diese Art der Debatte schlicht unsinnig und kann sogar zum ernsten Problem werden.
Verwaltungsrechtlerin„Bürokratieabbau kann neue Bürokratie-Folgen haben“
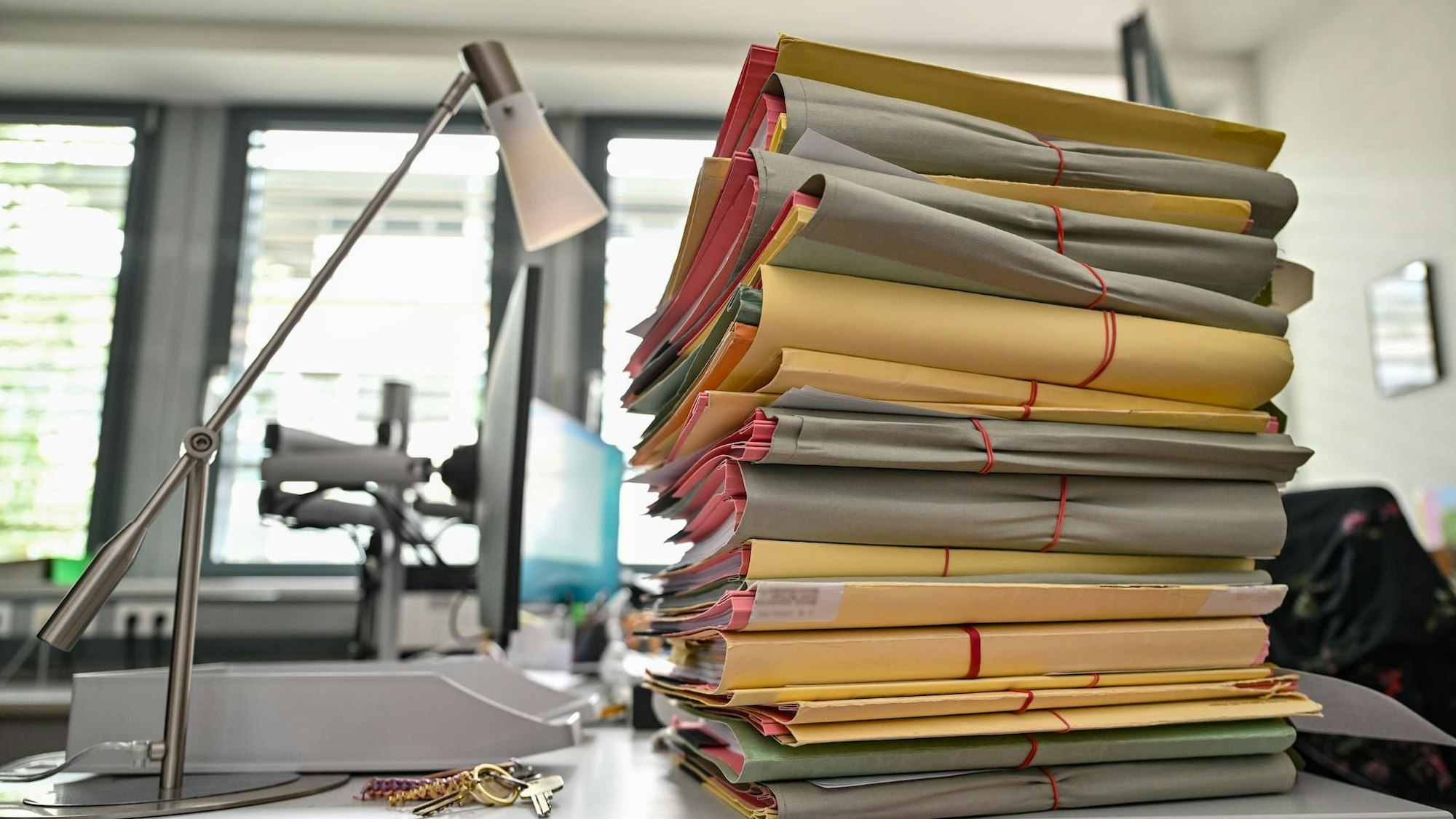
Dokumentationspflichten belasten auch Kommunen.
Copyright: Patrick Pleul/dpa
Die Bürokratie, das Feindbild von Politikern jeglicher Couleur? Kaum eine Debatte kommt ohne das – stets als Vorwurf gemeinte – B-Wort aus. Pascale Cancik, Professorin für Rechts- und Verwaltungswissenschaften sagt im Interview mit Maik Nolte, warum die Diskussion meist inhaltsleer ist, wie sie letztlich die Demokratie gefährdet und warum Bürokratieabbau mitunter sogar zu neuer Bürokratie führen kann.
Frau Cancik, wenn Sie das Wort „Bürokratie“ im täglichen Diskurs hören, was ja momentan quasi ständig der Fall ist, zucken Sie da eigentlich innerlich zusammen?
Ja, mittlerweile zucke ich zusammen, weil es so häufig verunklarend verwendet wird und man in der Regel nicht genau weiß, worum es konkret geht – zugleich aber die politischen Folgerungen, die damit verbunden werden, oft sehr weitgehend sind. Das ist für die Debatte ein Problem, sowohl für die allgemein politische als auch für eine konkrete Verwaltungs- oder Rechtsreformdebatte, um die es gegebenenfalls geht.
Hierzulande heißt es, wenn man sich über die Verwaltung ärgert, oft: „Typisch Deutschland!“ Ist die Bürokratie hierzulande denn wirklich so viel ausgeprägter, umständlicher, komplexer als in anderen Ländern?
Nein, das glaube ich nicht. Wir kennen ähnliche Diskussionen und Kritik auch in anderen Staaten. Das ist an sich ja auch was ganz Normales, ich würde das gar nicht als Krisenbefund betrachten, dass man mit Verwaltungen nicht immer zufrieden ist. Ein Problem ist, dass die vielen Fälle, in denen Verwaltungen funktionieren, typischerweise nirgends auftauchen. Psychologisch ist das sehr leicht zu erklären; wir nehmen stärker wahr, was uns nicht gefällt. Solche Kritik bezieht sich mittlerweile sehr stark auch auf die europäische Ebene.
Alles zum Thema Europäische Union
- Nord-Stream-Anschlag Straftat, Verstoß gegen das Völkerrecht – oder legitime Militäraktion?
- EU-Urteil Alkoholfreies Getränk darf nicht als Gin verkauft werden
- Poker im Kanzleramt Ist das angestrebte Aus für Verbrenner verfrüht?
- EU-Einigung Weniger Bürokratie und Kontrollen für Landwirte
- Oliver Zander „Bei den Sozialreformen ist die SPD ganz klar der Bremsklotz“
- Rundschau-Debatte Geht es bei Merz um Wirtschaft statt Klimaschutz?
- Gänsebarometer Lust auf Gänsebraten? Tipps für den Kauf
Spielt es da vielleicht auch eine Rolle, dass die EU so weit weg wirkt? Ein Machtapparat, der zwar demokratisch legitimiert ist, bei dem man aber trotzdem das Gefühl hat, keinen richtigen Einfluss auf ihn zu haben?
Es hat sicher etwas mit der Entfernung zu tun. Und auch damit, dass die EU wegen ihrer Kompetenzen nur bestimmte Arten von Regelungsmöglichkeiten hat. Das heißt, sie ist darauf angewiesen, dass die Mitgliedstaaten diese gut umsetzen. Und das ist durchaus nicht immer der Fall. Es hat sicher auch damit zu tun, dass Kompromisse zwischen ziemlich vielen Akteuren gefunden werden müssen, was für Rechtsklarheit nicht immer eine gute Voraussetzung ist.
Und der dritte Punkt, warum die EU-Bürokratie besonders gerne angegriffen wird, ist natürlich, dass Politikerinnen und Politiker sich leicht von ihr als „dem Anderen“ distanzieren können; sogar dann, wenn sie selbst an bestimmten Regelungen beteiligt waren. Das funktioniert als politrhetorisches Spielchen relativ gut.
Stichwort „Bürokratieabbau“, auch das ein Begriff, der nicht wirklich greifbar ist. An welchen Stellen lässt sich Bürokratie denn sinnvoll vereinfachen?
Das kommt darauf an, was Sie jeweils unter Bürokratie verstehen. Natürlich gibt es viele Felder, die man auf mögliche Vereinfachungen überprüfen kann. Es geht darum, was genau man „abbaut“. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Zum Bürokratieabbau hat immer auch der Personalabbau gehört. Gleichzeitig hören wir jetzt immer wieder Klagen darüber, dass unsere Verfahren nicht schnell genug gehen, dass in manchen Verwaltungen nicht ausreichend kompetente Menschen arbeiten – das ist aber, jedenfalls in Teilen, eine Folge von früherem Bürokratieabbau. Daran kann man sehen, dass man mit diesem Wort alleine nicht gut bewerten kann, was man nun tun soll oder ob etwas gelungen ist.
Geht es nicht meistens eher darum, einfach nur Regeln abzuschaffen? Sprich, ist Bürokratieabbau nicht eigentlich Deregulierung?
Die Entwicklung des Wortgebrauchs geht in diese Richtung, das sehen wir seit den 1970er Jahren und dann vermehrt seit den 1990ern. Was früher eher auf Beamtentum und Verfahren gezielt hat, wurde immer mehr durch Kritik an „übermäßiger“ Regulierung ersetzt. Teilen der Wirtschaft etwa geht es in der Tat um Abbau etwa von Umweltrecht, Verbraucherschutz oder Steuerrecht.
Paradoxerweise spricht einiges dafür, dass kompliziertes Recht, etwa die viel kritisierten Dokumentationspflichten, seinerseits eine Folge von früheren Entbürokratisierungen ist. Wir haben mehr in die Verantwortung von Unternehmen übertragen, im Umweltrecht beispielsweise, also mehr auf Selbstregulierung gesetzt. Oder wir steuern mehr über Anreize durch Subventionen. Das sind aber Steuerungsmechanismen, die dann fast zwingend Dokumentationspflichten nach sich ziehen – der Staat muss ja nachhalten können, ob Fördermittel zweckentsprechend verwendet werden. Insofern denke ich, dass ein Teil der Klage, die sich auf Regulierung, auf Recht bezieht, letztlich auch auf Steuerungsinstrumente im Zusammenhang mit Privatisierung und Liberalisierung zurückgeht. Das zeigt, dass Bürokratieabbau neue Bürokratie-Folgen haben kann.
Über Dokumentationspflichten ächzen nicht nur Unternehmen, sondern auch Kommunen. Dort ist der Unmut über die Förderstrukturen groß, Kommunalverbände fordern etwa Pauschalbeträge, um das Prozedere zu vereinfachen. Ist das ein Ansatz, den man verfolgen könnte?
Ja, das glaube ich schon. Nur muss sich die jeweils fördernde politische Ebene klar sein, dass sie dann weniger Steuerungs- und Kontrollzugriff hat. Sie muss dann damit leben, dass vielleicht Dinge passieren, die man sich anders vorgestellt hat. Und man muss natürlich ein Mindestmaß an rechtlicher Kontrolle sicherstellen, dass es nicht zu einer zweckwidrigen Verwendung von Geldern kommt. Aber ich würde das gerade in diesem Bereich der Förderung von Aufgaben der Kommunalverwaltungen absolut zielführend finden.
Wie lässt sich die Debatte denn sinnvoller führen?
Regelungskritik erfordert aufwendige, kleinteilige Analyse unter Einbeziehung von Verwaltungspraxis, muss auf Kosten, aber auch auf den Nuten von Regelungen blicken. Das Problem ist nicht, dass man Verwaltung oder Recht kritisiert – das ist in einer Demokratie ganz normal. Das Problem ist, dass wir das mit einer verunklarenden Begrifflichkeit tun, die populistisch anschlussfähig ist und mittlerweile auch immer mehr in dieser Weise genutzt wird. Analysiert wird dann nicht die konkrete Regelung, ein konkretes Problem, sondern plötzlich sind ganze Verwaltungen und damit eben auch der Rechtsstaat in Verdacht und letztlich auch die Demokratie.
Wir können an den USA sehen, wohin undifferenziertes Verwaltungs-Bashing führen kann. Dass Dinge, die in einer rechtsstaatlich-demokratischen Ordnung in gewissem Sinne normal sind, als so schwierig und anstrengend empfunden und so negativ befrachtet werden, dass irgendwann Kettensägen als Lösung ausgegeben werden – das ist eine gefährliche Entwicklung. Nicht zuletzt müssen wir konkreter und ehrlicher über Aufgaben reden: Wie viel Klimaschutz wollen wir? Wie viel oder wie wenig Verbraucherschutz? Wie viel Steuereinnahmenschutz. Diese Debatten kann man ja führen und den nötigen Mut dazu darf man der Politik ruhig abverlangen.
Und schließlich ist es sicher auch hilfreich, sich immer wieder mal klarzumachen, wie unglaublich viel unsere Verwaltungen leisten. Wir können in der Regel sicher über den Bürgersteig laufen, die Abfallentsorgung funktioniert und die Wasserversorgung auch, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

