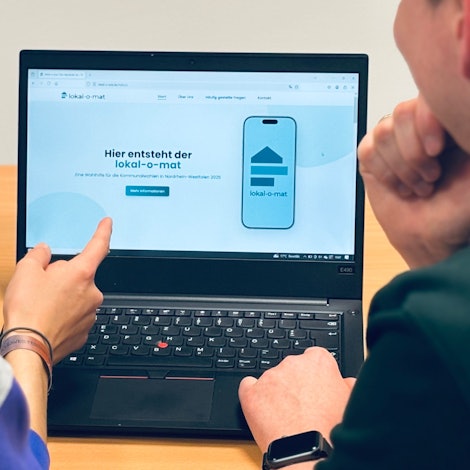Wie steht die neue Bundesregierung unter Friedrich Merz zwei Monate nach Amtsantritt da, und wie schlagen sich die Parteien in NRW? Darüber sprach die Rundschau mit Manfred Güllner, dem Chef des Forsa-Instituts.
Forsa-Chef zum NRW-Check„Der Landes-Bonus der NRW-CDU ist ungebrochen“

Manfred Güllner, Geschäftsführer des Forsa-Instituts
Copyright: picture alliance/dpa
Beim letzten NRW-Check waren die Sorgen um die Wirtschaft noch ganz klar die größte Problem-Priorität der Befragten. Das hat sich jetzt allerdings stark verändert. Warum?
Das ändert sich im Augenblick fast täglich, je nachdem, welche Meldungen gerade über krisenhafte ökonomische Entwicklungen verbreitet werden. Wir haben ja zu einem Zeitpunkt gefragt, als über die Migrationspolitik und deren Folgen heftig diskutiert wurde. Die Werte des NRW-Checks sind also eine Momentaufnahme.
Das heißt aber nicht, dass die Ökonomie plötzlich an Bedeutung verloren hätte. Dem Missverständnis darf man nicht unterliegen. Man sieht auch in den bundesweiten Umfragen, dass die ökonomische Lage nach wie vor für die Menschen wichtig ist und sie auch erwarten, dass gerade da etwas passiert.
Alles zum Thema Hendrik Wüst
- Der Oberberg-Cartoon Bei der aktuellen Handball-EM kann auch der VfL-Schal getragen werden
- Achtjähriger ist Politik-Fan Wie Finn aus Wesseling zu einem Treffen mit Hendrik Wüst kam
- Hoher Besuch Ministerpräsident Hendrik Wüst besucht Christkindpostfiliale in Engelskirchen
- Sondervermögen NRW steckt 31 Milliarden Euro in Bildung und Infrastruktur
- Attacke in Köln Steinewerfer vom Eigelstein ist wohl schuldunfähig
- „Blaue Engel“ THW-Ortsverband Schleiden feiert doppeltes Jubiläum
- Nach der Flut Aufräumarbeiten in Bedburg sind noch lange nicht abgeschlossen
Das Thema Migration scheint ja der Umfrage zufolge auch immer noch wichtig zu sein, obwohl sich die Lage derzeit weniger angespannt darstellt, als es noch vor einem Jahr der Fall war.
Über Migration wird vor allem deshalb immer noch diskutiert, weil die Union mit Friedrich Merz das Thema zum Hauptthema im Wahlkampf gemacht und dann auch noch angekündigt hat, ab dem ersten Tag der Kanzlerschaft sofort die Grenzen zu schließen. Insofern geht es jetzt gar nicht mehr um die objektive Situation, sondern das Thema hat in der politischen Diskussion einen hohen Stellenwert.
In den kleineren Gemeinden, wo man den direkteren Draht zum Bürgermeister und zur Verwaltung hat, ist es leichter, für die Reparatur eines Klos, eines Daches oder eines Fensters in den Schulen zu sorgen.
Bei diesem NRW-Check sind auch viele kommunalpolitische Themen abgefragt worden. Bei der Zufriedenheit mit einem Teil der kommunalen Infrastruktur-Angebote wie zum Beispiel Pflegeeinrichtungen oder dem Zustand der Schulen - gibt es ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. Wie ist es zu erklären, dass Menschen in kleineren Orten damit eher zufrieden sind?
Das dürfte damit zusammenhängen, dass die Lösungen in den Städten und vor allem in den urbanen Metropolen – also den Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern wie Köln – wohl schwieriger zu erreichen sind. Wir sehen auch, dass die Stadtverwaltungen in den Großstädten schlechter bewertet werden und man ihnen nicht zutraut, den Zustand beispielsweise der Schulen wirklich zu ändern. In den kleineren Gemeinden, wo man den direkteren Draht zum Bürgermeister und zur Verwaltung hat, ist es leichter, für die Reparatur eines Klos, eines Daches oder eines Fensters in den Schulen zu sorgen.
Im aktuellen NRW-Check ist auch deutlich geworden, dass die Menschen in den kleineren Gemeinden tendenziell andere Parteien wählen als bei Bundes- und Landtagswahlen. Wie würden Sie das einordnen?
Häufig wird auch von Politikwissenschaftlern behauptet, es gäbe eigentlich keine eigenständige kommunale Politikebene und bei Kommunalwahlen wäre das Ergebnis eigentlich nur ein Reflex der politischen Großwetterlage. Das ist aber falsch.
Das sehen wir ganz eindeutig auch in den aktuellen Ergebnissen des NRW-Checks. Da sagen ja die Wahlberechtigten, dass für sie bei der Kommunalwahl die Politik vor Ort das Entscheidende bei ihrer Wahl ist und nicht die Bundes- oder Landespolitik.
Nun ist die Situation von Gemeinde zu Gemeinde, von Stadt zu Stadt, sehr unterschiedlich, so dass tatsächlich je nach Zustand und Erscheinungsbild sowie der Einschätzung der Kompetenz der Parteien vor Ort diese völlig anders beurteilt werden als die Parteien auf Bundes- oder Landesebene.
Bei der Abfrage der bundespolitischen Stimmung hat sich herausgestellt, dass die Menschen noch mehrheitlich unzufrieden sind mit der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz. Warum?
Das ist schon erstaunlich: Die große Mehrheit der Bundesbürger und auch der Bürger an Rhein und Ruhr war mit der Ampel unzufrieden und eigentlich froh, dass sie zu Ende war. Sie waren voller Hoffnung, dass mit der neuen Regierung vieles besser werde. Aber diese frohe Hoffnung hat sich bisher noch nicht erfüllt.
Das liegt auch an Merz, der seine vollmundigen Versprechungen vor der Wahl zur Schuldenbremse in der Wahrnehmung der Bürger gebrochen hatte. Und diese Diskrepanzen zwischen Ankündigungen und tatsächlichen Handeln halten bis heute an. Dabei konnten wir die Debatte um die Strompreise im NRW-Check noch gar nicht einfangen.
Und Merz hat den Schwerpunkt seiner Tätigkeit in den ersten Tagen und Wochen auf die Außenpolitik gelegt, ist in der Welt herumgefahren und hat sich auf internationaler Bühne präsentiert. Das wird auch honoriert, aber Außenpolitik ist für die Entscheidung bei Wahlen in Deutschland nie wichtig gewesen.
Die Innenpolitik ist viel wichtiger, aber da ist Merz noch nicht richtig sichtbar geworden, so dass man mit seiner Arbeit mehrheitlich noch wenig zufrieden ist – genauso wenig wie mit der Arbeit der Bundesregierung insgesamt.
Es haben fast alle Mitglieder der NRW-Landesregierung bei der Frage, ob ihre Fähigkeiten als gut eingeschätzt werden, eingebüßt. Das betrifft selbst Hendrik Wüst und beliebte Minister wie Reul und Laumann. Andererseits wird die Zufriedenheit mit der Regierung insgesamt aber gleich gut bewertet wie beim letzten NRW-Check. Wie ist das zu erklären?
Die Zufriedenheit geht ja bei Hendrik Wüst nicht allzu stark zurück. Wir stellen aber jetzt ein Erstarken der AfD auch in Nordrhein-Westfalen fest, obwohl rechtsradikale Parteien hier historisch und auch bei den letzten Wahlen eher unterdurchschnittlich Stimmen eingesammelt haben.
Jetzt aber gibt es für die AfD tatsächlich einen klaren Zuwachs. Und die AfD -Anhänger sind unzufrieden mit allem, was die Altparteien - wie sie von der AfD genannt werden – und deren Politiker tun. Wenn es bei den Wahlberechtigten insgesamt mehr AfD-Anhänger gibt, sinkt dadurch auch der Durchschnittswert selbst für angesehene Politiker wie Herbert Reul oder Hendrik Wüst.
Da sollte man aber nicht überinterpretieren, gerade was die Wüst-Zahlen anbelangt. Dennoch erreicht die CDU auch in NRW nicht mehr den hohen Wert, den wir im letzten NRW-Check ermittelt hatten. Dafür ist aber in starkem Maße die Unzufriedenheit mit Merz verantwortlich. Er nutzt der NRW-CDU nicht, sondern schadet ihr.
Ursprünglich war Nordrhein-Westfalen ja ein CDU-Land. Das zu ändern, hat die SPD nur dadurch geschafft, dass sie vor Ort vertrauenswürdige Politiker hatte, die entsprechend auch wahrgenommen wurden
Wenn man sich aber das Ergebnis der letzten Landtagswahlen anschaut, liegt die CDU beim NRW-Check diesmal sogar wieder besser als bei ihrem letzten Ergebnis, im Gegensatz zu den Grünen und der SPD: Wie ordnen Sie das ein?
Trotz des gewissen Rückgangs gegenüber unserer letzten Umfrage genießt die Landes-CDU mit Wüst immer noch einen deutlichen Bonus gegenüber der Bundes-CDU mit Merz. Vergleicht man die Zufriedenheit mit der Arbeit des Ministerpräsidenten und mit der des Bundeskanzlers, dann gibt es da ja einen Riesen-Unterschied.
Der Landes-Bonus der NRW-CDU ist somit ungebrochen und auch die positive Beurteilung von Wüst im Vergleich zu Merz hat sich nicht geändert. Deswegen würde die CDU immer noch ein deutlich besseres Ergebnis erzielen als bei der Landtagswahl im Mai 2022. Bei der SPD ist es hingegen so, dass nach wie vor auf Landesebene eigentlich kein politischer Akteur sichtbar ist.
Das zeigt sich auch an der Person Jochen Ott, der ist ja kaum bekannt. Er mag allenfalls in Köln ein wenig bekannter sein. Das zeigt, dass die NRW-SPD kein Personal anbieten kann, das bekannt, geschweige denn populär ist. Die SPD findet in Nordrhein-Westfalen eigentlich gar nicht mehr statt.
Und der Rückgang bei den Grünen dürfte eine Folge der bundesweiten Entwicklung sein. Die haben durch ihre Politik in der Ampel an Sympathien eingebüßt und schon bei der Bundestagswahl weniger Stimmen bekommen. Und das beeinflusst auch die Präferenzwerte auf Landesebene.
Innerhalb der Landeregierung kommen die Grünen relativ schlecht weg, gerade wenn man sich die Beliebtheitswerte der einzelnen Ministerinnen und Minister anschaut. Sind das quasi noch Nachwehen der Ampel?
Das sind Nachwehen der Ampel, denn die Grünen waren vor der Bundestagswahl 2021 und bei ihrem überaus guten Ergebnis bei der Europawahl 2019 auf dem Weg zu einer Partei, die auch für die politische Mitte wählbar werden konnte.
Mit dem damaligen Führungsduo Baerbock und Habeck, das einen modernen und pragmatischen Politikstil verkörperte, war das auch machbar. Und wenn Baerbock nicht so viele Fehler im Wahlkampf gemacht hätte, wären die Grünen 2021 noch stärker geworden. In der Ampel aber haben sie sich zurückentwickelt zu einer Partei, die eher bevormunden will.
Das heißt, dieses alte Bild der Grünen als Bevormundungspartei ist während der Zeit der Ampel-Regierung wieder deutlich geworden: Symbol dafür war das Heizungsgesetz. Da hatten viele den Eindruck, die schreiten jetzt wirklich jedem in den Keller und sagen, was dort gemacht werden muss. Das hat das positive Bild der Grünen von vor 2021 wieder zerstört.
Somit sind sie auf dem gewollten Weg zur Volkspartei nicht weitergekommen, sondern sind zurückgefallen auf ihre Kernklientel. Das kann man jetzt in Nordrhein-Westfalen genauso beobachten.
60 Prozent aller Wahlberechtigten und auch 57 Prozent der SPD-Wähler geben beim NRW-Check an, dass sie sich zur Arbeit des Oppositionsführers Jochen Ott im Landtag keine Einschätzung zutrauen. Ist er zu unsichtbar?
Der wird genauso wenig wahrgenommen wie der SPD-Vorstand in NRW, da weiß auch keiner, wer das ist. Das ist das Schlimmste, was einer Partei passieren kann, wenn sie wie in NRW gar nicht mehr wahrgenommen wird. Die SPD müsste alles daransetzen, in der Wählerschaft wieder wie früher verankert zu sein.
Die SPD war in Nordrhein-Westfalen stark geworden, weil sie auf lokaler Ebene Vertrauen gewonnen hatte – was auch in Köln der Fall war. Dieses große lokale Vertrauen hat die SPD dann auf Landes- und Bundesebene übertragen. Ursprünglich war Nordrhein-Westfalen ja ein CDU-Land. Das zu ändern, hat die SPD nur dadurch geschafft, dass sie vor Ort vertrauenswürdige Politiker hatte, die entsprechend auch wahrgenommen wurden – vor allem ihre Bürgermeister und Oberbürgermeister.
Diese Verankerung in der Wählerschaft hat die SPD auch in Nordrhein-Westfalen völlig verloren. Mit ihrer Renaissance müsste sie also wieder auf der kommunalen Ebene beginnen. Doch die SPD kann in vielen Städten in NRW derzeit bei der Wahl zum Stadtoberhaupt keine Kandidaten anbieten, die das Vertrauen haben, wie es früher mal vorhanden war.