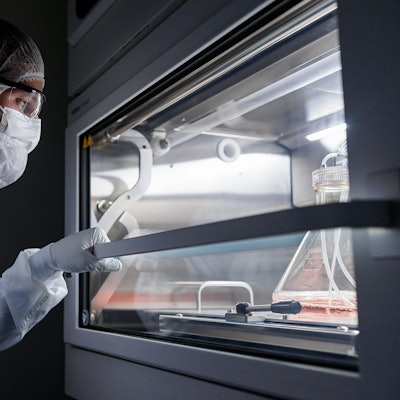Tabea Thies verbindet Phonetik und Neurologie mit dem Ziel der Früherkennung von Parkinson. Bernd Imgrund sprach mit ihr über Forschung, Religion und die Liebe.
Forscherin in Köln„Wer wild träumt, bekommt Parkinson? Vereinfacht gesagt, ja“

Dr. Tabea Thies forscht in Köln zum Thema Parkinson.
Copyright: Nabil Hanano
Sie sind nach 13 Jahren von Köln nach Berlin gezogen. Wie kann man so etwas tun?
Die Liebe ist schuld. Das ist der einzige Grund, sonst wäre ich noch hier. Natürlich ist es spannend, neue Perspektiven und ein neues Arbeitsumfeld zu bekommen. Aber noch vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich hier wegziehe.
Warum nicht?
Köln ist meine Heimat geworden. Ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet und bin 2012 zum Studium hierhin. Ich fühle mich hier wohl, ich liebe die kölsche Frohnatur. Alles ist so locker, die Menschen sind nett und offen und akzeptieren einander.
Für den Umzug nach Berlin hatten Sie 100.000 Euro zur Verfügung.
(lacht) Sie meinen den Förderpreis für meine Arbeit. Das Geld muss ich natürlich für die Forschung benutzen. Ich habe noch nicht alles ausgegeben, aber einiges an Laborequipment für Sprachaufnahmen gekauft. Wir wollen ja die Sprechveränderungen bei Parkinson erfassen.
Alles zum Thema Bernd Imgrund
- Kölner Sportlerin Maduka „Ich habe meinen Weg gefunden“
- „Aufgeben ist keine Option“ Kölnerin Linda Mai wird ukrainische Honorarkonsulin
- Kölner Baarkeeper „Ein Drink muss ein Ziel haben und einem Zweck dienen“
- Vorsitzende der Goethe-Gesellschaft Köln „Lesen ist Erleben, das funktioniert nicht mit kurzen Schnipseln“
- Ferienprogramm Auf Entdeckertour in der eigenen Stadt – das bietet „Urlaub in Köln“
- Genossenschafts-Kneipier „An der Theke sind in Köln alle gleich“
- Kölner Büchsenmacher „Die Waffe ist ein Werkzeug des Jägers“
Legen Sie den Rest in ETFs an?
Das Geld wird von der Finanzabteilung der Uniklinik verwaltet. Will ich etwas anschaffen, muss ich vorher fragen. Und dann wird geprüft, ob der Forschungszweck gegeben ist. Hat Ihre wissenschaftliche Forschung für Sie auch einen spielerischen oder ästhetischen Aspekt? Es ist vor allem Wissenschaft. Kreativ wird es immer erst, wenn man sich neue Studien ausdenkt oder überlegt, wie welches Phänomen erfasst werden sollte. Da ist stets das ganze Team gefragt.
„Ich wusste lange nicht, wohin mit mir“, haben Sie in einem Interview gesagt. Waren Sie in Ihrer Essener Zeit so ein verzweifeltes junges Mädchen kurz vor der Drogensucht?
So schlimm war es nicht. Aber ich war sehr unmotiviert. Ich war ziellos, hatte keinen Bock aufs Abi und wusste nicht, wofür ich in die Schule gehe. Ich fand das ganze System blöd, auch die Notengebung. Ich war einfach faul, so kann man das sagen. Immerhin hat mich Biologie ein bisschen interessiert, aber studiert habe ich das dann auch nicht.
Waren Sie wenigstens ein Pferdemädchen?
Nee, gar nicht. Ich habe immer gesagt, ich werde Pathologin. Zum Scherz, weil ich dachte, die sind schon tot, da kann ich nichts mehr falsch machen. Einen richtigen Berufswunsch hatte ich nie, alles ist irgendwie passiert.
Wie ist Ihnen „Köln“ passiert?
Das war auch wegen der Liebe.
Und wenn Ihr nächster Freund aus Timbuktu kommt?
(lacht) Es wird keinen nächsten Freund geben.
Eine schöne Antwort! Für eine „Orientierungslose“ haben Sie es mit Anfang 30 recht weit gebracht. Gab es einen Schlüsselmoment?
Es war ein Kurs zu akustischer Phonetik, der mich gepackt hat. Und dann bin ich auf die Arbeitsgruppe „Brain Modulation and Speech Motor Control“ aufmerksam geworden, die Phonetik und Neurologie kombiniert. Da geht es zum Beispiel um tiefe Hirnstimulation. Das ist ein Therapieverfahren, in dem man Elektroden ins Gehirn implantiert, um dann Parkinson, Dystonie oder Essentiellen Tremor zu therapieren. In der Phonetik geht es um Lautbildung.
Was könnten Sie uns mit Ihrem Fachwissen über die Sprechweise der Vögel sagen?
Oh, die Vögel produzieren wie wir auch unterschiedliche Laute, die nur anders gebildet werden. Mit mehr oder weniger Anblasdruck zum Beispiel. Lautstärke, Tonhöhe, Dauer, Regelmäßigkeit: Das sind alles Parameter, die man beim menschlichen Sprechen auch untersucht. Sie forschen zu Sprechverlust und Parkinson.
Was ist das wirklich Neue an Ihrem Ansatz, oder anders gefragt: Was rechtfertigt die 100.000 Euro?
(lacht) Der Goldstandard war bislang, dass entweder ein Sprachtherapeut oder ein Kliniker gesagt hat: Okay, Sprechproblem auf einer Skala von Null bis Vier, das Ergebnis ist völlig subjektiv. Jeder Mensch unterliegt Tagesschwankungen, heute bewertet man das so, morgen anders. Wir wollen die Forschung zur Parkinson-Erkrankung schon 20 Jahre vor den offensichtlichen Störungen ansetzen. Im Kern untersuchen wir die sogenannte REM-Schlaf-Verhaltensstörung.
Wer wild träumt, bekommt Parkinson? Vereinfacht gesagt, ja.
In 80 Prozent der Fälle trifft das leider zu. Und dabei geht es nicht nur um Parkinson, sondern um das Atypische Parkinson Syndrom oder eine Form von Alzheimer-Demenz. Wir können bislang noch keine fertige Theorie anbieten, es liegt noch viel Aufklärungsarbeit vor uns. Ideal wäre, die Schlafstörung frühzeitig zu erkennen und ein Medikament zu entwickeln, um den Parkinson-Prozess aufzuhalten.
Wie können Sie 20 Jahre vor dem offensichtlichen Ausbruch eine Parkinson-Erkrankung erkennen?
Dafür machen wir unsere Sprechaufnahmen. Es geht um kleinste, nicht wirklich hörbare Unterschiede. Wir können zum Beispiel feststellen, wann die Tonhöhenmodulation ein bisschen eingeschränkt ist und dass es ein paar kleine Normabweichungen und artikulatorische Defizite gibt.
Müssten Sie einen Menschen nicht von seinem ersten bis letzten Lebenstag sprachlich verfolgen, um die Nuancen mitzubekommen?
Im Idealfall schon, aber das will man natürlich nicht. Aber wenn die REM-Schlaf-Verhaltensstörung bekannt ist, könnte man frühzeitig aktiv werden und wenn gewünscht herausfinden: Wird es ein Parkinson? Wird es etwas Atypisches und geht in die Demenzschiene? Oder hat der Mensch Glück und es bleibt bei der Schlafstörung?
Hilft viel reden gegen Parkinson? Das käme dem Klischeekölner ja entgegen.
Ich würde sagen: begrenzt. (lacht) Aber was immer hilft, ist Bewegung. Parkinson ist ja eine motorische Erkrankung. Wer die Muskeln stärkt, sei es durch Sport, Spazierengehen oder auch Singen im Chor, beugt vor.
In meinem Tischtennisverein, dem 1. FC Köln, gibt es eine PPP-Abteilung: Ping-Pong-Parkinson.
Ja, das ist wunderbar. Beim Sport gelingt es Parkinson-Patienten, für einen kurzen Moment nochmal alle Ressourcen zu bündeln und dann eben auch einen guten Tischtennis-Schlag hinzubekommen. Man nennt das Phänomen „paradoxe Kinesie“. Übertrieben gesagt: Der Patient, der eigentlich im Rollstuhl sitzt, rennt plötzlich aus dem brennenden Gebäude.
Sehr faszinierend! Um bei den Klischees zu bleiben: Hilft Biertrinken?
Eher weniger. Das ist eine andere Form der Sprechstörung, denn beim betrunkenen Sprechen sind andere Hirnareale beeinträchtigt. Betrunkene sind für uns allerdings eine gute Kontrollgruppe, um die akustischen Eigenschaften dieser Sprechstörung zu untersuchen.
Was hat man davon zu wissen, dass man in 20 Jahren unheilbar krank sein wird?
Okay, jetzt wird es dramatisch. Es gibt diese Fragen schon lange: Liegt Krebs in der Familie, hat man eine genetische Prädisposition, will man das wissen, und möchte sein Leben danach ausrichten? Sagen wir so: Wer früh genug Bescheid weiß, kann den Umgang mit der Erkrankung zunächst lenken. Vielleicht wird man motiviert, die Weltreise zu machen, von der man immer schon geträumt hat. Aber ich gebe auch zu: Parkinson ist zur Zeit noch nicht heilbar, es gibt keine Medikamente, die die Krankheit aufhalten.
So what?
Meine These ist, dass mit der Sprechtherapie bei Parkinson viel früher begonnen werden müsste, als es bisher geschieht. Und unsere Sprechaufnahmen könnten dazu dienen, die Sprechstörung früh zu erkennen. Wenn man therapiert, wird zwar nichts besser, aber man kann das Funktionslevel länger aufrecht erhalten. Das wäre doch schön, oder?!
Ist das die Hoffnung, die Sie mit Ihrer Arbeit verbinden?
Es geht um Früherkennung, ja. Sprechen verrät sehr viel über das menschliche motorische System. Spannend finde ich auch die Kompensationsstrategien: Der Mensch merkt, er ist auf herkömmlichem Wege nicht mehr in der Lage, etwas Bestimmtes auszudrücken oder zu tun, also entwickelt er Ausweichstrategien. Das haben wir bei unseren Untersuchungen der REM-Schlaf-Verhaltensgruppe ebenfalls festgestellt. Der Sprechaufwand wird dadurch größer, und die neue Strategie funktioniert eine Zeitlang gut. Irgendwann kippt es, weil der Parkinson reinkickt. So oder so lernen wir mit solchen Forschungen, den menschlichen Körper besser zu verstehen.
Sind Sie religiös?
Nee, gar nicht.
Sie kommen nicht in den Himmel und trinken mit Einstein Kaffee?
Ich denke, nein. Woran glauben Sie, Frau Thies? An Zahlen und Fakten. Aber natürlich auch an das Gute im Menschen.